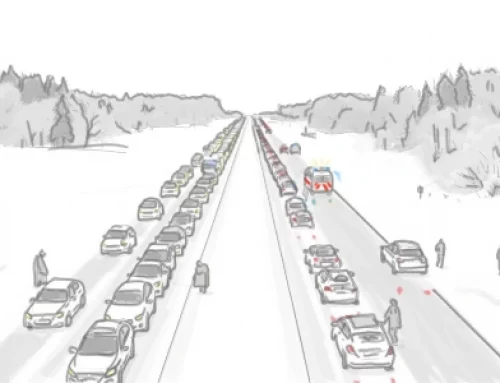Das Jubiläum
Thomas Mann, der „am 6. Juni 2025 150 Jahre alt geworden wäre“, wurde auch in einem ehemaligen Hamburger Nachrichtenmagazin ordentlich gewürdigt. Man kann sich jedoch schwerlich vorstellen, dass der Autor eines solchen Satzes eine besonders gute Beziehung zum Werk Thomas Manns oder überhaupt zur deutschen Sprache unterhält. Thomas Mann wäre an diesem Tag tatsächlich hundertfünfzig Jahre alt geworden, wenn er nicht siebzig Jahre zuvor gestorben wäre. Es ist überhaupt schwer zu sagen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssten, dass Thomas Mann oder irgendein anderer Mensch hundertfünfzig Jahre alt geworden sein könnte. Aber mit einer solchen Aussage sollte offensichtlich die Illusion genährt werden, Thomas Mann sei ein Zeitgenosse der Gegenwart. Ein Blick auf die Feuilleton-Würdigungen, die Thomas Mann anlässlich der 150-Jahresfeiern seines Geburtstages erfahren hat, zeigt das Gegenteil: Thomas Mann ist der Gegenwart fremd geworden.
Eigentlich hätte man erwarten dürfen, dass die Feuilletons ebenso wie die Politik sich Thomas Mann zur Beute machen würden, den Routinen des Jubiläumsbetriebes folgend. Aber ganz so ist es nicht gekommen. Gewiss gibt es hinreichend Würdigungen des Jubiläumstages, und man hat auch nichts unversucht gelassen, um dem Publikum der Gegenwart Thomas Mann schmackhaft zu machen. Aber schon die Festrede des Bundespräsidenten beim „Festakt der Stadt Lübeck zum 150. Geburtstag“ am 6. Juni 2025 fiel unerwartet verhalten aus. Viel ist den Redenschreibern nicht eingefallen, über eine lexikalische Auflistung dessen, was Thomas Mann alles so gesagt, geschrieben und erlebt hat, kommt der Redebeitrag nicht hinaus. Und als Aktualitätsbezug hätte man sich von diesem Bundespräsidenten eigentlich mehr erwartet als einen Halbsatz, dass Thomas Mann „das heutige Amerika“ – gemeint ist sicher: der „heutige amerikanische Präsident“ – nicht gefallen hätte. Das damalige „Amerika“, also die USA, hat ihm übrigens auch nicht gefallen; deshalb hat er es 1952 verlassen. Eine süddeutsche Zeitung mit überregionaler Verbreitung verspricht in ihrem Artikel über eben diesen Festakt Auskunft darüber, „Was Thomas Mann zu Trump gesagt hätte“; so lautet die Überschrift. Man wird es nie erfahren; auch die Autorin des Artikel weiß es nicht, mehr noch: der Name „Trump“ kommt in dem Artikel überhaupt nicht vor. Aber die Redaktion dieser Zeitung hatte die sichere Intuition, dass der Name „Trump“ in der Überschrift eine größere Anziehungskraft hat als der Name „Thomas Mann“.
Auch sonst ist es nicht ganz leicht, Thomas Mann dem heutigen Publikum schmackhaft zu machen. Dass er homosexuell war, gehört nicht zu den allerspektakulärsten Ergebnissen der Thomas-Mann-Forschung, und es reicht heute auch nicht mehr. Wenn man lange genug im „Tonio Kröger“ und im „Tod in Venedig“ herumliest, kann man ihn auch queer lesen; ein netter Versuch, der neue Leserschichten in der LGBTQ+-Gemeinde erschließen könnte. Einen Migrationshintergrund hat er auch. Seine Mutter war in Brasilien geboren. Der Großvater war ein Plantagenbesitzer aus Lübeck; die Großmutter war eine portugiesisch-kreolische Brasilianerin. Mehr kann man nicht verlangen. Aber vor allem: Er war Antifaschist; allerdings einer, der mit seinem Kampf gegen Hitler nicht erst siebzig Jahre nach dessen Tod begonnen hat.
In den Feuilleton-Würdigungen zum 150. Geburtstag wurde also alles zusammengetragen, was ihn den heutigen Zeitgenossen sympathisch erscheinen lassen könnte, und seine gelegentlichen antisemitischen Halbtöne kommen ihm in der aktuellen deutschen Stimmungslandschaft eher zugute, als dass sie befremdlich wirkten. Jedenfalls bietet Thomas Mann hinreichend Anschlussstellen an die Hauptströmungen des gegenwärtigen Zeitgeistes. Es erfordert keine große Mühe den Eindruck zu erwecken, dass er ein Zeitgenosse der Gegenwart sei. Im Gegenteil: Je weniger Mühe man sich gibt mit dem Werk des Autors, desto näher erscheint er denen, die sich an ihm vergreifen. Die 13-bändige Werkausgabe aus den 1970er Jahren umfasst rund 10 000 Seiten. da findet sich für jeden etwas, was man gerade brauchen kann. Man muss nur schnell genug blättern.
Aber dennoch: So richtig warm werden wollten weder die Medien noch die Politik mit diesem Jubiläum. Die Jubiläumsmaschinerie kam etwas zäh in Gang. Das hat seine Gründe.
Ein deutscher Schriftsteller
Denn es hilft alles nichts: Thomas Mann ist ein deutscher Autor. Es gibt wohl keinen Schriftsteller deutscher Zunge, der sich so viel Gedanken gemacht über seine eigene Zugehörigkeit zur deutschen Kultur hat. Als er 1938 amerikanischen Boden betrat für ein dann 14-jähriges Exil in den USA, diktierte er den amerikanischen Reportern, die den weltberühmten Autor im Hafen von New York empfingen, in die Feder: „Where I am, there is Germany. I carry my German culture in me.“ Die Zeitläufte brachten es mit sich, dass er diesen Satz auf Englisch sagen musste. Im Jahr darauf allerdings konnte man im 7. Band der 8. Auflage von „Meyers Lexikon“, im „Nazi-Meyer“, lesen, Thomas Mann sei nun „ aus der dt. Volksgemeinschaft ausgeschlossen“.
Thomas Mann war seit 1936 tschechoslowakischer und ab 1944 US-amerikanischer Staatsbürger. Mit einem Offenen Brief in der „Neuen Zürcher Zeitung“ sagte er sich im Februar 1936 vom nationalsozialistischen Deutschland los und erklärte, dass er ein Land meiden müsse, „in dessen geistiger Überlieferung ich tiefer wurzele als diejenigen, die seit drei Jahren schwanken, ob sie es wagen sollen, mir vor aller Welt mein Deutschtum abzusprechen.“ Die Universität Bonn reagierte sofort auf die Winke der Politik und entschloss sich, ein Zeichen zu setzen und Haltung zu zeigen. Sie hatte Thomas Mann 1919 die Ehrendoktorwürde zuerkannt und sie ihm 1936 aberkannt, kurz nachdem er die deutsche Staatsbürgerschaft verloren hatte. Aber neun Jahre später, die Zeiten hatten sich geändert, beeilte man sich, ihm die Ehrendoktorwürde hurtig wieder zuzuerkennen. Elegant war das nicht, aber schlau: Damit ersparte man sich die Diskussionen, die bis heute an deutschen Universitäten über verliehene oder eben verweigerte Ehrungen während der NS-Zeit geführt werden. Man hätte erwarten können, dass nach diesen Erfahrungen ihm das Deutschtum verleidet sei, wie so vielen anderen vertriebenen Schriftstellern, Künstlern und Wissenschaftlern. Aber Thomas Mann machte gute Miene zum bösen Spiel, aus dem Bewusstsein und Selbstbewusstsein heraus, dass er, und nicht die anderen, der Repräsentant der deutschen Kultur sei.
Ganz leicht hat man es Thomas Mann also nicht gemacht mit seiner Zugehörigkeit zu Deutschland, und leicht hat er es sich auch nicht gemacht. Nach dem Krieg gab es einige Kontroversen darüber, ob er denn nun zurückkehren wolle oder solle. Damals war Thomas Mann in Westdeutschland ein ziemlich umstrittener Autor. Zurückgekehrt in einem biographischen Sinne ist er nicht. Aber 1949 hielt er seinen Vortrag zu Goethes 200. Geburtstag und betrat aus diesem Anlass erstmals seit 1933 wieder deutschen Boden – im Osten wie im Westen. Denn den Vortrag hielt er in den beiden Goethe-Städten Frankfurt und Weimar. Das wurde im Westen mit Zähneknirschen und heimlichem Groll, im Osten mit großem Jubel aufgenommen. In der DDR verehrte man den Nobelpreisträger, und er ließ es sich gerne gefallen, zumal man dort trotz Devisenknappheit ordentliche Tantiemen zahlte. Besondere Sympathie für die DDR wollte er damit wohl nicht zum Ausdruck bringen, anders als sein Bruder Heinrich, der sich in der DDR niederlassen wollte, jedoch kurz zuvor starb.
Thomas Mann hat sich hinreichend oft geäußert über sein Selbstverständnis, sein Verhältnis zu Deutschland und seine Meinung zu den Zeitläuften. Doch Selbstaussagen sind nicht für bare Münze zu nehmen. Schriftsteller sind keine verlässlichen Gewährsmänner, wenn es um sie selbst geht. Man muss ihr Werk beim Wort nehmen. Dann erscheint Thomas Mann als ein deutscher Autor, nicht weil er es gesagt hat, sondern weil er in deutscher Sprache geschrieben hat, die deutsche Sprache weiterentwickelt hat, weil er aus dem tiefsten Brunnen der deutschen Vergangenheit geschöpft, und weil er das alles auch selbst sehr genau gewusst und gewollt hat. Er ist ein Autor, der von dem nicht lassen wollte, was die deutsche Kultur in ihren Höhen und Tiefen hervorbracht hat; eine Kultur, zu der eben nicht nur Goethe und Schiller, Nietzsche und Wagner – mit denen Thomas Mann sich zweifellos auf Augenhöhe wähnte –, sondern zu der auch „Bruder Hitler“ und der Pakt mit dem Teufel gehören.
Aus diesem Fundus der deutschen Kultur schöpfen zu können, hat er sich mit großer Mühe angeeignet. Thomas Mann war ein Kaufmannssohn; Bildungsbürger zu sein, war ihm nicht in die Wiege gelegt, und er ist es auch nie geworden. Für den Abschluss einer eigentlich sechsjährigen Schullaufbahn benötigte er neun Jahre, an der Technischen Hochschule München hat er zwei Semester lang Vorlesungen zu literarischen und ästhetischen Themen gehört, das belegen die überlieferten Kolleghefte. Ob er tatsächlich als gebührenpflichtiger „Zuhörer“ eingetragen war, ist nicht dokumentiert. Der Kaufmannsohn wusste sein Geld zusammenzuhalten, davon konnten seine Verleger einiges berichten. Seine dubiose Bildungslaufbahn hat Thomas Mann zeitlebens geschmerzt, in mehreren Lebensläufen, auch dem für das Nobelpreiskomitee, spricht er von den „Münchener Hochschulen“ – im Plural – die er als „Hörer“ besucht habe. Den eigenen Lebenslauf .etwas aufzuputzen, ist kein Privileg von Politikerinnen des 21. Jahrhunderts.
Aneignungen und Entfremdungen
Es ist das Recht einer jeden Epoche, sich ihre Klassiker neu und auf eigene Weise anzueignen. Denn das macht die Eigenart klassischer Werke aus: dass sie die Zeiten überdauern. Nicht beliebig aber ist, wieviel Gewalt man den Werken der Vergangenheit antun und welchen Zwecken man sie dienstbar machen darf. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Thomas Mann für eines seiner Werke den „Deutschen Buchpreis“ der Leipziger Buchmesse erhalten hätte. Denn leicht konsumierbare Gefälligkeitsliteratur sind seine Werke wahrlich nicht. Sie sind verfasst in einem höchst anspruchsvollem, einem elitären, einem widerständigen Deutsch, das sich der schnellen Lektüre nicht erschließt. Und es ist ein doppelbödiges Deutsch: Thomas Mann war einer der großen Meister der Ironie, der Parodie, des Humors; kaum ein Satz beschränkt sich auf das, was er sagt. Fast immer schwingt eine zweite Bedeutung mit.
Das Urheberrecht hat Thomas Manns Werk bislang davor bewahrt, in gekürzten und für den Schulgebrauch zurechtgestutzten Versionen auf den Markt geworfen zu werden. Aber die Schutzfrist läuft in wenigen Monaten aus, und es ist leicht vorhersagbar, dass dann Ausgaben des „Doktor Faustus“ in leichter Sprache erscheinen werden – oder mit „behutsamen Kürzungen und textlichen Vereinfachungen“, wie es bei schutzlos gewordenen klassischen Texten längst üblich und zum guten Geschäft geworden ist. Und wenn auch das nicht mehr geht, gibt es den „Zauberberg“ als „Graphic Novel“. Der Genderstern ist ihm schon ganz nah gerückt: Die im Entstehen begriffene, auf 38 Bände angelegte „Große kommentierte Frankfurter Ausgabe“ seines Hausverlages wird von „Herausgeber*innen“ ediert. Ob ihm das Recht gewesen wäre, weiß man nicht. Wahrscheinlich nicht. Zu Beginn des Jahres 2026 wird der Buchmarkt mit Werken aus der Feder Thomas Manns überschwemmt werden. Sie werden sich auch ordentlich verkaufen, denn ganz abgelebt ist Thomas Mann noch nicht. Als Phantomschmerz eines untergegangenen Bildungsbürgertums ist er dem Kulturbetrieb noch ziemlich präsent.
Aber das wird ihm nicht gut bekommen. Denn Thomas Manns Werke sind Botschaften aus einer fremden Welt, einer Welt, die mit der heutigen nichts gemein hat, zugänglich nur den Lesern, denen diese heutige Welt ebenfalls fremd geworden ist. Wer Gewinn aus der Lektüre von Thomas Manns Werken ziehen will, muss bereit sein, dieses Fremde in seinem Werk fremd sein zu lassen.
Weltbürger wider Willen
Thomas Mann ist weit herumgekommen in der Welt, meist unfreiwillig. Sein erster kurzzeitiger Exilort war Sanary-sur-Mer in Frankreich, 1933 ging er in die Schweiz, nach Küsnacht, mit einem kurzen Aufenthalt in der Tschechoslowakei zur Entgegennahme der dortigen Staatsbürgerschaft, schließlich emigrierte er 1938 in die USA, und seine letzten drei Lebensjahre verbrachte er wieder in der Schweiz. Zweimal wechselte er die Staatsbürgerschaft. Im gesamten Erzählwerk sind praktisch keine Spuren dieser bewegten Migrationsgeschichte zu finden; es handelt fast ausschließlich von deutschen Angelegenheiten. Der deutscheste seiner Romane, „Dr. Faustus“, wurde von einem amerikanischen Staatsbürger unter der kalifornischen Sonne am Strand von Pacific Palisades in Los Angeles verfasst.
Thomas Manns Werk gehört zur Weltliteratur, das ist unbestritten; um das einzusehen, hätte es nicht des Nobelpreises von 1929 gebraucht. Aber es gehört nicht zu der „Weltkultur“, die gerade dabei ist, sich herauszubilden, eine Weltkultur, die von hochsubventionierten globalen Kulturnomaden am Leben gehalten wird, reisenden Impresarios, die Heute hier und Morgen dort ihre Ausstellungen, ihre Biennalen und documentas eröffnen, um ihre politischen Ansichten zu verbreiten. Damit wird eine wortlose Weltkultur geschaffen, welche alle nationalen und regionalen Kulturlandschaften auslöscht.
Thomas Manns Werk wird kein Teil dieser Weltkultur werden. Denn anders als die Musik, die bildenden Künste, die Architektur ist Literatur unausweichlich in einer Nationalsprache verfasst, und die ist im Falle Thomas Manns nun einmal deutsch. Der Blick auf das wirkliche Werk Thomas Manns, nicht seine politischen Äußerungen, sondern seine Romane, Novellen, Essays, eröffnet eine untergegangene Welt, in der Nationalkulturen noch eine Rolle spielten. Es widersetzt sich der schnellen Aneignung.
Wer wissen will, wem Thomas Mann gehört, sollte dem Rat Arno Schmidts folgen: Der hat empfohlen, man solle nicht auf den Geburtsort schauen – das wäre in diesem Fall die ungeliebte Hansestadt Lübeck –, sondern auf den Ort, wo er gestorben ist und begraben wurde. Thomas Manns Grab liegt auf dem Friedhof von Kilchberg, am Zürcher See. In Zürich wird auch sein Erbe bewahrt. Der Nachlass Thomas Manns liegt nicht in Lübeck und nicht in München; er liegt im Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich.
Wenn eine Nation Anspruch auf Thomas Mann erheben könnte, dann wäre es die neutrale Schweiz. Denn hierhin hat er sich zweimal zurückgezogen; einmal nach Küsnacht, in der vergeblichen Erwartung der baldigen Endes des NS-Spukes, und einmal 1952 nach Kilchberg, als ihm sein Gast- und neues Heimatland, dessen Staatsbürger er war, langsam genauso unheimlich wurde wie sein deutsches Vaterland, in das zurückzukehren er sich weigerte, allen Schalmeienklängen aus dem Osten und allen verlogenen Lockrufen aus dem Westen zum Trotz.