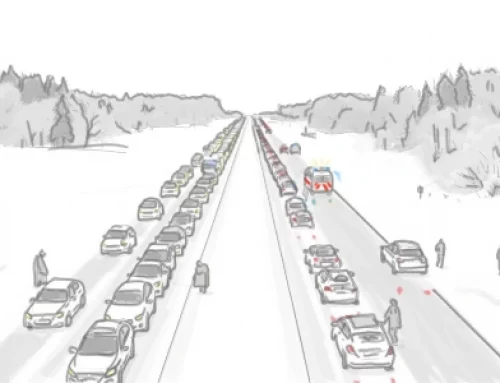Der Abschied
Jetzt sind sie weg. Die im Februar 2025 abgewählten Bundesminister, die im Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium sowie im Auswärtigen Amt maßgeblich zum Scheitern ihrer Regierung beigetragen haben, haben ihre Ämter verloren. Das liegt in der Natur der Sache. In einer Demokratie gibt es nun einmal Ämter nur auf Zeit, auch wenn es den Betroffenen oft schwer fällt, das einzusehen. Wer diese Ämter bekommt, entscheidet der Wähler, jedenfalls war das ursprünglich einmal so gedacht. So richtig verstanden haben es die beiden aber nicht, dass man sie in ihren Ämtern nicht mehr sehen wollte. Die eine fand eine neue Aufgabe in New York, deren Bedeutungslosigkeit ihren Fähigkeiten angemessen ist und für deren üppige Alimentierung der deutsche Steuerzahler weiterhin aufkommen muss. Der andere hat sich nach langem Grübeln entschieden, dass das deutsche Volk seiner nicht wert sei.
In einem bemerkenswerten, in der Geschichte der Bundesrepublik singulären Interview für die ihm nahestehende Milieuzeitung „taz“ gab er noch einmal eine Probe seiner vielgerühmten rhetorischen Fähigkeit: Neuen Wind unter den Flügeln wolle er spüren; er gehe „jetzt komplett ins Offene“, erläuterte er mit einer feinsinnigen, dem eigenen sprachlichen Niveau angepassten Hölderlin-Anspielung. Aber hinter aller hochgebildeten Feinsinnigkeit verbirgt sich eben doch eine Proletennatur, die zum Ausdruck drängt: Das „fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder“ habe ihn verstört, und der Bundestagspräsidentin bescheinigt er „Dämlichkeit“ und „Unfähigkeit“ – der Stachel der Bedeutungslosigkeit sitzt tief beim ehemaligen Liebling der Hauptstadtkorrespondentinnen. Seinen Wählern widmet er kein Wort. Habeck hat eine ratlose Anhängerschaft zurückgelassen, die ihn etwas mühsam zum tragischen Helden stilisiert, um sein Scheitern nicht als das eigene wahrnehmen zu müssen.
In einem ihrer wenigen lichten Augenblicke haben die deutschen Wähler dafür gesorgt, dass dieser Spuk ein Ende hat. Jetzt steht die Frage im Raum: Wer kommt danach? Die Nachfolgeregierung erweist sich schon nach wenigen Wochen als ein Notkabinett, in dem um des puren Machterhalts willen zusammengewürfelt wurde, was nicht zusammen gehört. Es ist ein Kabinett von Politikern alten Typs; das Durchschnittalter liegt bei 53 Jahren und die politischen Ambitionen beschränken sich darauf, konsequent zu Ende zu führen, was die Vorgänger schon falsch gemacht.
Die TikTok-Königin
Die Nachfolgegeneration ist gerade dabei, sich neu zu sortieren. Nachdem der Abgeordnete Habeck seinen Wählern das ihm anvertraute Bundestagsmandat vor die Füße geworfen hatte, wird ihm eine 26-jährige „Masterstudentin der internationalen Politik und des internationalen Rechts“ folgen. Neben dem Studium ist sie Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten und sieht sich selbst als Politikerin mit dem Schwerpunkt „Mietpreisbremse“. Der Themenwechsel ist dringend nötig. Deutsche Wähler sind geduldig, zu geduldig. Aber der rasante Umschwung von einer Umweltschutz- zu einer Naturverwüstungspartei und vom Pazifismus zum Bellizismus war dann doch eine Wendung zu viel.
Mit einem Themenwechsel wird es jedoch nicht getan sein. Auch der Politikstil unterliegt einem Wandel. Das sichtbarste Phänomen dieser Entwicklung ist die Fraktionsvorsitzende der Partei „Die Linke“, früher SED. Die Partei erhielt 8,8 Prozent der Stimmen. Das ist weit entfernt von den Ergebnissen, die diese Partei früher bei den Volkskammerwahlen der DDR erhielt. Aber für bundesrepublikanische Verhältnisse ist das ein beachtliches und vor allem ein sehr überraschendes Ergebnis, das gegen alle Erwartung erzielt wurde.
Diesen Erfolg verdankt die Partei ihrer Spitzenpolitikerin Heidi Reichinnek. Sie ist eine von zwei Fraktionsvorsitzenden im Bundestag. Von ihrem Co-Vorsitzenden hat man noch nie etwas gehört; er heißt übrigens Sören Pellmann. Aber er würde bei der Selbstinszenierung der Partei nur stören, die ganz auf das Konzept „Reichinnek“ zugeschnitten ist. Mit ihrem Politikstil hat sie den Nerv einer spezifischen Wählerklientele getroffen. Das Geheimnis ihres Erfolges ist eine offensive und ostentativ zur Schau gestellte Entintellektualisierung und Entsprachlichung des politischen Diskurses. Sie spricht eine Wählergeneration an, die ihre Wahlentscheidungen nicht auf das Studium von Parteiprogrammen oder die Teilnahme an politischen Diskursen gründet, sondern auf Videoclips in Social-Media-Kanälen. Und auf TikTok gehört Heidi Reichinnek zu den Reichweiten-Königinnen.
Auch das Öffentlich-Rechtliche Fernsehen bietet Personen dieses Typs im Kielwasser ihrer TikTok-Prominenz gerne eine große Bühne. Als die Fraktionsvorsitzende in einer Fernsehdiskussion Ende April 2025 um eine Faktenunterfütterung ihrer Behauptungen und Wunschvorstellungen zur Wohnungsenteignung und Mietpreisbremse gebeten wurde, verbat sie sich solche Fragen, die ihr schon zu ihrer Schulzeit als unzumutbar erschienen waren. Das kommt gut an in ihrer Generation, denn so haben sie es in der Schule gelernt. Die Vorstellung der Unzumutbarkeit des Ansinnens, etwas wissen zu sollen, wird deutschen Schülern, speziell Gymnasiasten, seit mindestens zwei Generationen mit zunehmendem Erfolg vermittelt. Während die vorhergehende Politikergeneration sich immerhin noch um Bildungssimulation bemühen musste, um eine faktenbasierte Legitimität ihres politischen Handelns vorzutäuschen, kann die neue Generation sich ganz ungeniert damit brüsten, nichts zu wissen.
Im TikTok-Milieu herrschen andere Gesetze als Sachkunde und die Überzeugungskraft des besseren Arguments. Schon bei der Außenministerin konnte man feststellen, dass sie wesentlich schneller reden als denken konnte; und bei der Fraktionsvorsitzenden Reichinnek hat sich das Reden noch einmal beschleunigt und verselbständigt. Wer trotzdem versucht, ihr zuzuhören und den Sinn der Wörter zu entschlüsseln, misst die Fraktionsvorsitzende an Maßstäben, die nicht die ihren sind.
Die Politisierung des Körpers
Auf das Reden kommt es nicht mehr an. Jetzt kommt der Körper zu seinem Recht. Ernst H. Kantorowicz hat in den 1950er Jahren seine berühmte Studie über „Die zwei Körper des Königs“ vorgelegt. Gemeint war die mittelalterliche Herrschaftsauffassung, nach der der physische Körper des realen Königs aus Fleisch und Blut getrennt wahrgenommen wurde vom virtuellen und unsterblichen Körper des Monarchen als Repräsentanten eines unsterblichen Amtes; eine Trennung, die sich über die Jahrhunderte fortsetzte und bis in die Demokratien hinein als Trennung von Amt und Person fortwirkte. Im hypermedialen Zeitalter ist diese Trennung in rasanter Auflösung begriffen, bis zu dem Punkt, wo der Körper selbst als politische Aussage wahrgenommen werden konnte.
Die scheidenden Minister hatten schon erste tastende Versuche unternommen, sich in dieser neuen politischen Stilwelt zurechtzufinden, in der sie nicht zu Hause waren. Baerbock hat ihre Körperlichkeit mit Hilfe einer nicht ganz billigen Stylistin – für deren Kosten aber freundlicherweise der Steuerzahler aufkam – ganz konventionell, aber überstilisiert inszeniert. Um nicht wie eine „Totengräberin“ auszusehen – die sie ja in einem metaphorischen Sinne durchaus war –, ließ sie ihr Antlitz so lange bearbeiten, bis nur noch eine glatt gespachtelte Oberfläche zu sehen war. Ihr Ministerkollege und innerparteilicher Kontrahent ging den umgekehrten Weg. Er inszenierte seine physische Erscheinung gepflegter Verwahrlosung so lange, bis ihn ein Kolumnist ungestraft in die Nähe von „Bahnhofsalkoholikern“ rücken konnte. Wesentlich konsequenter war die zeitweilige Bundessprecherin der gleichen Partei, Ricarda Lang. Ihre Adipositas wurde zum politischen Programm der „fat positivity“ umgedeutet und obendrein gab es noch das Bekenntnis, sie sei „die erste offen bisexuell lebende Abgeordnete des Deutschen Bundestages““ – was immer das heißen mag, aber es klang nach einem politischen Programm. Das hat eine Zeitlang funktioniert und ihr eine Karriere eingebracht, mit der sie nach Lage der Dinge eigentlich nicht hätte rechnen dürfen. Kaum war die politische Laufbahn – wohl nicht ganz freiwillig – beendet, unterzog sie sich einer erfolgreichen Diät, heiratete ganz trivial einen Mann, was sie zuvor ihre politische Karriere gekostet hätte, und gab in einer Homestory Auskunft über ihren Kinderwunsch.
Reichinnek geht bei der Politisierung des Körpers einen radikalen Schritt weiter. Ihre physische Erscheinung wird dominiert von den Tätowierungen auf ihren Armen, deren Bedeutung sie im April 2025 dem Fachblatt für politische Gegenwartskunde „Bunte“ bereitwillig erklärt hat. Abgebildet sind unter anderem die Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands, Rosa Luxemburg, und die Gemahlin des ägyptischen Königs Echnaton, Nofretete, die mit einer Gasmaske versehen wird. Das soll eine Anspielung auf den Beginn des Arabischen Frühlings in Kairo sein. Die Tätowierungen verhelfen einer politischen Botschaft zum Ausdruck, die die Trägerin nicht mehr in Sprache fassen kann, weil ihr die Worte fehlen.
Wer wählt so etwas?
Jung, schrill und ahnungslos heißt das Erfolgsrezept. Das beantwortet auch die Frage, wer so jemanden wählt: Es sind ihresgleichen. „Die Linke“ erzielte bei der Bundestagswahl 2025 4 356 532 Zweitstimmen. Im August 2025 veröffentlichte die Bundeswahlleiterin eine präzisierte Analyse des Wahlverhaltens, die einige Überraschungen brachte. Neu war die Erkenntnis, dass die Partei „Die Linke“ einen stark überdurchschnittlichen Stimmenanteil bei jungen Wählern erhalten hat. In der Alterskohorte der 18‑ bis 24-jährigen waren es 27 Prozent, bei den 25‑ bis 34-jährigen 21,2 Prozent. Noch signifikanter ist die Auswertung nach Geschlecht und Alterskohorte. Bei den 18- bis 24-jährigen wurde „Die Linke“ von 37,1 Prozent der weiblichen Wähler gewählt, bei den 25- bis 34-jährigen waren es 21,2 Prozent. In der Summe ergibt das in diesen beiden Altersgruppen rund 1 027 800 Wählerinnen: Frauen, die sich von den binären und bisexuellen Angeboten der vergangenen Legislaturperiode nicht mehr repräsentiert und sich vom vergilbten Bahnhofsalkoholikercharme nicht mehr angezogen fühlen, wenden sich einer Hardcore-Verbalkommunistin ihrer eigenen Generation zu.
Deren Programm ist einfach und verführerisch, wenn auch nicht originell: Es heißt „soziale Gerechtigkeit“. „Soziale Gerechtigkeit“ bedeutet für diese Partei die Entkopplung von Lohn und Leistung, und in konkrete Politik umgesetzt bedeutet das: „Enteignung“. Den größten Wählerzuspruch fand diese Partei in Berlin mit rund 20 Prozent, den geringsten in Bayern mit 5,7 Prozent. Dieser Befund steht im unmittelbaren Zusammenhang damit, dass das Geld der Öffentlichen Hand, das man in Berlin ausgibt, zum großen Teil in Bayern erwirtschaftet wird. Dort, wo gearbeitet wird, findet die Forderung nach Enteignung nun einmal geringere Resonanz als dort, wo man vom Geld anderer Leute lebt.
Die Revolution
Dass Frauen besonders revolutionsgeneigt sind, zeigt ein Blick in die Geschichte. Neugierigen Journalisten erzählte die Fraktionsvorsitzende Reichinnek, ihr Team habe ihr „eine Hyänen-Patenschaft geschenkt“ und sie wolle sich auch eine Hyäne auf den Arm tätowieren lassen, dort, wo noch Platz ist. Da in diesem Milieu bildungsbürgerliche Grundkenntnisse nicht sonderlich verbreitet sind, war das Geschenk wohl nicht als Anspielung gemeint. Man kann es aber so verstehen: „Da werden Weiber zu Hyänen“, heißt es 1799 in Schillers „Lied von der Glocke“. Das war nicht nur aus einer misogynen Stimmung heraus so daher gesagt, sondern bezog sich konkret auf den Marsch der Frauen auf Versailles zehn Jahre zuvor, am 6. Oktober 1789.
Das politische Programm der Fraktionsvorsitzenden hat seine historischen Wurzeln nicht in der bürgerlichen Französischen Revolution, sondern in der sowjetischen Oktoberrevolution und dem Berliner Spartakus-Aufstand vom Januar 1919. Darauf verweist das dem linken Unterarm eintätowierte Porträt Rosas Luxemburgs. Auch wenn Reichinnek ihr Praktikum in Kairo 2010 und 2011 nicht bei der parteieigenen Rosa-Luxemburg-Stiftung, sondern ganz bieder beim Klassenfeind, nämlich der Konrad-Adenauer-Stiftung, absolvierte – das verschweigt sie lieber im offiziellen Lebenslauf der Bundestags-Website –, steht sie der Diktatur des Proletariats näher als der sozialen Marktwirtschaft.
Die Berufung auf Rosa Luxemburg enthält ein vages politisches Programm, das man in den Texten Luxemburgs genauer nachlesen kann als auf dem Unterarm der Fraktionsvorsitzenden. Rosa Luxemburg war eine ambivalente Figur. Sie war eine ernstzunehmende Theoretikerin, die in den innermarxistischen Grabenkämpfen der Jahrhundertwende eine wichtige Rolle spielte, und auch als Vorkämpferin für den Tier‑ und Naturschutz könnte man sie in Anspruch nehmen. Aber ob sie als politische Leitfigur einer demokratischen Gesellschaft in Frage kommt, ist eher zweifelhaft. Eine ihrer letzten Schriften – „Was will der Spartakusbund?“ vom Dezember 1918 – zeigt sie als Predigerin der „revolutionären Gewalt des Proletariats“, sie feiert die „Diktatur des Proletariats“ als „wahre Demokratie“, fordert die „Beseitigung aller Parlamente“ und natürlich „Enteignung“: „Konfiskation aller Vermögen von einer bestimmten Höhe an“ – das sind Sprüche von vorgestern. Die „Beseitigung aller Parlamente“ steht heute auch bei den linkesten der Linken nicht mehr auf dem Programm, denn damit würde man sich selbst die Existenzgrundlage entziehen; aber die Forderung nach „Enteignung“ hat in Berlin wieder einen guten Klang. Und der „gewaltigste Bürgerkrieg“, den sich Luxemburg gewünscht hat, ist auch nicht mehr in allzu weiter Ferne.
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von rechtsradikalen Freikorps-Soldaten brutal ermordet; ihre Leichen wurden in den Berliner Landwehrkanal geworfen und erst Monate später aufgefunden. Zwei Tage später hielt Max Weber in Heidelberg eine Wahlkampfrede für die „Deutsche Demokratische Partei“ und ging auch auf diese Morde ein: „Die Diktatur der Straße hat ein Ende gefunden, wie ich es nicht gewünscht habe. Liebknecht war zweifellos ein ehrlicher Mann. Er hat zum Kampf der Straße aufgerufen – die Straße hat ihn erschlagen“.
„Die Revolution frißt ihre Kinder“, ließ Georg Büchner seinen Danton sagen. Das wird auch diesen Minnie-Mouse-Revolutionärinnen im Deutschen Bundestag nicht anders gehen. Auch wenn sie zum Kampf der Straße aufrufen – erschlagen wird sie die Straße gewiss nicht. Sie werden zu den vielen Sternschnuppen gehören, die der deutsche Politikbetrieb im Schulterschluss mit den angeschlossenen Medien in den letzten Jahren immer wieder hervorgebracht hat und wieder hat untergehen lassen. Sie sind Kunstfiguren, die ein momentanes, künstlich erzeugtes und schnell wieder verschwindendes Bedürfnis befriedigen. Wahrscheinlich werden sie bald durch Avatare der Künstlichen Intelligenz ersetzt. Merken würde man es nicht.
** *
Am Sonntag, 24. August 2025, wurde im Kontrafunk“-Internetradio in der Reihe „Audimax – das Kontrafunkkolleg“ der Hörfunkvortrag
„Alternative Fakten“. Über Wahrheit und Lüge in der Politik
von Peter J. Brenner gesendet.
Die Sendung ist im Podcast hier gebührenfrei verfügbar
Mit dem Lügenvorwurf gegen Politiker ist man heute schnell zur Hand, und meistens auch zu Recht. Aber politisches Handeln unterliegt anderen Grundsätzen als der private Umgang; und generell waren Philosophen wie Theologen seit der Antike erstaunlich milde in ihrer Bewertung der öffentlichen Lüge. Viel problematischer als die individuelle Lüge des Politikers sind jene sich auf Fakten, auf Statistiken, auf Modellierungen berufenden Wahrheitssimulationen, welche die klassischen Ideologen als Legitimationsgrund von Herrschaft abgelöst haben