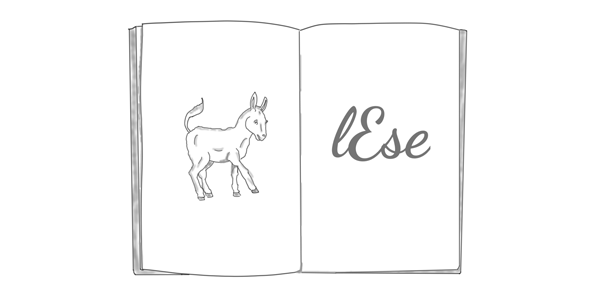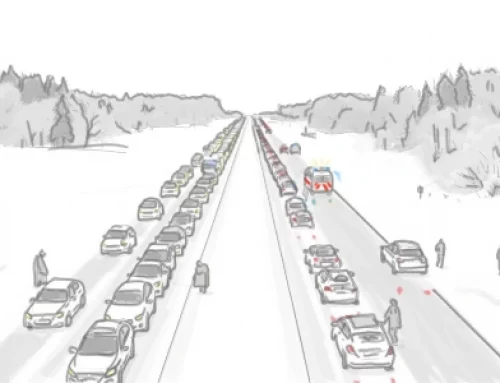Wer braucht schon Rechtschreibung …
Die deutsche Sprache macht es einem wirklich nicht leicht, das muss man zugeben. Deshalb wird immer mal wieder diskutiert, wie man sie leichter machen kann. So hat der Ministerpräsident des Pisa-Musterlandes Baden-Württemberg kürzlich seine Ansicht mitgeteilt, dass er den Rechtschreibunterricht an deutschen Schulen übertrieben finde. Da heute, und in der Zukunft erst recht, ohnehin nur noch am Computer geschrieben werde, reichten die von der künstlichen Intelligenz bereitgestellten Hilfsmittel völlig aus, um die zum korrekten Sprachgebrauch erforderliche, aber schwindende natürliche Intelligenz zu kompensieren. Was den Ministerpräsidenten dazu bewogen hat, gerade jetzt sich in dieser Weise zu äußern, weiß man nicht. Er steht jedenfalls nicht allein mit seiner Ansicht. Die Auffassung, dass man allzu viel Aufhebens mache mit dem Schriftsprachunterricht in der Schule, gewinnt zusehends an Boden.
Aber der Ministerpräsident hat Unrecht. Rechtschreibfehler sind keine Kavaliersdelikte, auch heute nicht, und wer der nachwachsenden Generation die schulische Herausforderung vorenthält, die deutsche Sprache in allen ihren Facetten und Finessen korrekt zu erlernen, der untergräbt die kulturellen Bindekräfte, welche die Gesellschaft zusammenhalten, und lähmt den politischen Diskurs.
„Die schreckliche deutsche Sprache“
Es ist ja richtig: Lesen und Schreiben gehören zu den unnatürlichsten Tätigkeiten, denen ein durchschnittlicher Mensch im Alltagsleben nachgehen muss. Die Schriftsprache lernt man nicht von selbst, ohne gezielte Anleitung und eigene große Anstrengung ist sie nicht zu haben. Dafür ist die Schule da.
Aber ist Deutsch wirklich so schwer? Die Klage über die deutsche Sprache selbst ist schon älter. In einer viel zitierten Satire „The awkward German language“, „Die schreckliche deutsche Sprache“, von 1880 hat sich Mark Twain über die Eigentümlichkeiten der deutschen Sprache beklagt. Ein besonderer Dorn im Auge war ihm die Stellung des Verbs im Satz und die Möglichkeit zur unbegrenzten Kompositabildung. Nicht entgangen ist ihm aber auch, was heutige Genderspezialisten nicht mehr wissen oder nie gewusst haben: dass das grammatische und das biologische Geschlecht nichts miteinander zu tun haben.
Heute, eineinhalb Jahrhunderte später, müsste die Klage nicht mehr ganz so heftig ausfallen. Denn Deutsch ist leichter geworden. Der englisch sprechende Amerikaner würde vieles auch ohne Wörterbuch verstehen und er würde viele Wörter hören, die englisch klingen, ohne es zu sein. Gerne macht man sich über die Sprachpfleger und Puristen lustig, welche die deutsche Sprache vor fremden Einflüssen schützen wollten und wollen. Besonders viel Wesens gemacht wird seit langem über den Einfluss des Englischen – besser: des Amerikanischen – auf die deutsche Sprache. Ein Körnchen Wahrheit ist sicherlich dabei, aber diese Kritik versteigt sich leicht zu Kindereien, und ein gerüttelt Maß Antiamerikanismus steckt oft auch dahinter. Dass Sprachen einander beeinflussen, dass politisch, wirtschaftlich und nicht zuletzt militärisch dominierende Länder einen größeren Einfluss auf andere Sprachgemeinschaften haben als umgekehrt, dass schließlich Globalisierungsprozesse auch eine pragmatische Einigung auf eine lingua franca erfordern, sind Entwicklungen, die man gelassen hinnehmen kann.
Die Sprache und ihre Regeln
Häufig belustigen sich die echten, die wissenschaftlichen Sprachforscher über die populären Sprachkritiker, die zu wissen vorgeben, was richtiges und was falsches, was gutes und was weniger gutes Deutsch sei. Das festzulegen und zu beurteilen sei nicht Aufgabe der Sprachwissenschaft, heißt es dann, die Sprachwissenschaft beobachte und beschreibe, aber sie normiere nicht. Ganz richtig ist das nicht. Zu den vielen Zweigen der Sprachwissenschaft gehören neben den Königsdisziplinen der Grammatik und der Rechtschreibung auch die Phonetik, die Pragmatik, die Sprachgeschichte, die Sprachästhetik und eben die Sprachnormierung. Denn selbstverständlich kommt keine Sprache ohne Regeln aus. Sie müssen befolgt werden, wenn Sprache ihren Zweck erfüllen soll, und je moderner, komplexer und diverser eine Gesellschaft ist, desto klarer müssen die Regeln formuliert und desto strenger muss auf ihre Einhaltung geachtet werden.
Konrad Duden, der Urvater der deutschen Rechtschreibregulierung, hatte noch einen ganz pragmatischen Zugang zu dem Thema. Im Vorwort und in der Einleitung zu seinem Buch „Die deutsche Rechtschreibung“ von 1872 betonte er die Notwendigkeit, angesichts der Vielfalt der deutschen Dialekte die Schriftsprache zu vereinheitlichen. Als Gymnasiallehrer und Praktiker war Duden aufgeschlossen für pragmatische Lösungen. Rechtschreibdogmatismus lag ihm fern. Er wusste, dass die Rechtschreibung sich nicht auf Prinzipien verpflichten lässt – „historisch“ oder „phonetisch“ stand damals zur Debatte. Er wusste aber auch, dass die Sprache einem steten Wandel, einem „nie rastenden Werdeprozeß“ unterliegt, und dass die Schriftsprache dem sich nicht widersetzen darf; dass sie aber zugleich einen Stabilitätsanker bildet, der allzu schnelle und allzu beliebige Ausuferungen der gesprochenen Sprachentwicklung auf ihr rechtes Maß reduziert.
Erleichterte Sprache
Für den schulischen Umgang mit der deutschen Sprache hält die moderne Pädagogik, im Schulterschluss mit der Bildungspolitik, eine einfache Lösung bereit: Was schwer ist, muss leicht gemacht werden. Das war die Leitlinie der Rechtschreibreform, und das wird die Leitlinie des künftigen Sprachunterrichts in der Schule sein. Insbesondere das Vordringen der „Leichten Sprache“ ist ein in seiner Bedeutung kaum zu überschätzendes Signal. Ihre Ursprünge hat die „Leichte Sprache“ in dem Angebot, auch Personen mit geistiger Behinderung oder mit Lernschwierigkeiten sprachliche Teilhabe zu ermöglichen. Aber inzwischen zieht sie weit darüber hinaus ihre behördlichen, politischen und kommerziellen Bahnen. Seit 2011 ist der Begriff „Leichte Sprache“ auch behördlich etabliert mit der „Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung“, deren eher parodistisch wirkender Titel nicht gerade ein Beispiel für das ist, was sie verspricht.
Inzwischen gibt es Organisationen mit konkurrierenden Regelwerken und natürlich einen Buch‑, Medien‑ und Dienstleistungsmarkt, auf dem Hilfestellungen und zertifizierte Produkte angeboten werden. Das Konzept ist einfach: Alles, was schwer ist oder schwer zu sein scheint, weil man es nie ordentlich beigebracht bekommen hat, soll verschwinden: der Genitiv und der Konjunktiv, das Passiv und der Nebensatz, Fremdwörter und Metaphern und Zahlen über 1000 sowieso. Historische Daten sollen nicht verwendet werden; Geschichte reduziert sich auf die Formel „vor langer Zeit“. Dass Politiker fortschrittlicher Parteien ihre Programme und Website-Auftritte auch in „Leichter Sprache“ anbieten, versteht sich von selbst, auch wenn die Unterschiede zu ihrer normalen Sprache oft nicht sehr groß sind.
„Leichte Sprache“ für alle?
Nun könnte man das Ganze als gut gemeint und nicht so wichtig ablegen. Aber das Konzept zieht Kreise. Das lobbyistisch führende „Netzwerk Leichte Sprache“ schätzte 2016 den Adressatenkreis für „Leichte Sprache“ auf 40% der erwachsenen deutschen Bevölkerung, das wären 20 Millionen Menschen. Ausdrücklich erwähnt die Geschäftsführerin, ein Jahr nach der Flüchtlingskrise, neben den Behinderten und Migranten jetzt auch die Flüchtlinge als neue Kundengruppe.
Die „Leichte Sprache“ ist auch ein Versuch, Entwicklungen reglementierend wieder einzufangen, die sich im schulischen Alltag vielerorts längst etabliert haben. Die einschlägigen Phänomene sind bekannt: Sprachstrukturen werden vereinfacht, um die Kommunikation auf elementarem Niveau zu erleichtern; Schüler übertragen Strukturen der eigenen Ghettosprache auf Deutsch als Zweitsprache; die Wortfolge verändert sich, Präpositionen verschwinden ebenso wie manche Tempora.
Angesichts dieser Entwicklungen ist leicht vorhersehbar, dass der „Leichten Sprache“ in Schulen mit hohem Migrantenanteil die Zukunft gehört. Sie ist ein kommodes „Interlanguage“-Angebot für Zuwandererkinder, vor deren sprachlicher Sozialisation das deutsche Schulwesen an vielen Orten längst kapituliert hat.
Und nicht nur das Schulwesen. Auch im behördlichen Bereich setzt sich langsam die Auffassung durch, dass die „Amtssprache Deutsch“ nur noch eine von mehreren sprachlichen Optionen ist. Eher beiläufig wurde im Januar 2020 öffentlich bekannt, dass seit Oktober 2016 Hocharabisch zu den jetzt zwölf Fremdsprachen gehört, in denen die theoretische Führerscheinprüfung abgelegt werden darf. Neun dieser Sprachen sind Amtssprachen der EU; daneben sind Russisch, Türkisch und jetzt eben Arabisch zulässige Sprachen nach der Fahrerlaubnis-Verordnung. Seit dieser Neuordnung wurden mehr als 425 000 theoretische Führerscheinprüfungen auf Hocharabisch durchgeführt.
In politisch und ökonomisch einschlägig interessierten Kreisen wurde das als weiterer wichtiger Beitrag zur Integration gedeutet. Das kann man auch anders sehen. Aber wenn das inländische Nebeneinander mehrerer Sprachgemeinschaften jenseits der deutschen Amts‑ und Landessprache zur allgemein und auch behördlich akzeptierten Normalität wird, dann bedarf es einer rudimentären Verkehrssprache, die leicht zu erlernen und leicht zu verstehen ist, damit man sich wenigstens über das Notwendigste verständigen kann. Das könnte die „Leichte Sprache“ werden
Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Denn diese Entsprachlichung bedeutet die Entmündigung einer ganzen Generation, ob zugewandert oder nicht. Das „Teilhabe“-Versprechen der „Leichten Sprache“ und ihrer Derivate ist ein Betrug. Die Erleichterung der Sprache bedeutet vielmehr Exklusion, Ausschluss aus dem politischen Diskurs, Ausschluss aus der Gesellschaft mündiger Bürger, die sich im öffentlichen Räsonnement über ihre Interessen und über das Gemeinwohl verständigen, und Ausschluss schließlich aus der Kulturgemeinschaft, die sich zuallererst in einer gemeinsamen Sprache zusammenfindet.
Heinrich Böll hat vor langen Jahrzehnten in seinen „Frankfurter Vorlesungen“ einmal die schöne Wendung von einer „bewohnbaren Sprache in einem bewohnbaren Land“ gefunden. Aber wenn das Land unbewohnbar ist, wird es die Sprache auch, und umgekehrt gilt das ebenso.