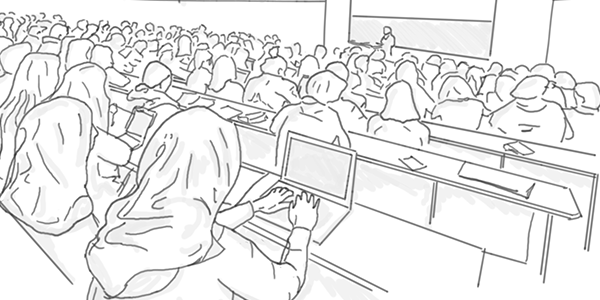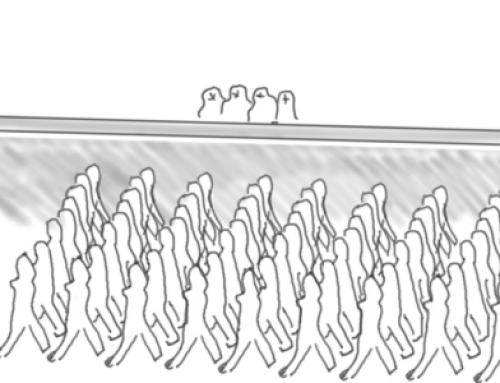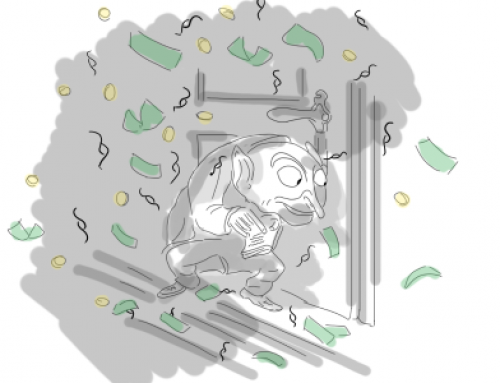Neue Kulturkämpfe an der deutschen Universität
Der Anlass: „Offene Kommunikation“ und ein verschleiertes Gesicht
Am 29. Januar 2019 hat das Präsidium der Kieler Christian-Albrechts-Universität eine Richtlinie zum Verbot von Gesichtsschleiern „in Forschung, Lehre und Verwaltung“ erlassen. Dabei ist es von der Prämisse ausgegangen, dass die „offene Kommunikation“ zu den Grundvoraussetzungen der Universität gehören und dass diese offene Kommunikation durch Gesichtsschleier verhindert werde. Ein Jahr lang widmete sich der Kieler Landtag daraufhin dem Thema mit dem Ziel, ein Verbot der Vollverschleierung an Schulen und Hochschulen gesetzlich zu regeln. Selbst die die Regierung mit tragende Fraktion „Bündnis 90/DIE GRÜNEN“ hat sich diesen Überlegungen zunächst nicht verschlossen. Denn wenn das Fremde ganz nah rückt, wird es unbehaglich. Was auf den Schulhöfen und in den Klassenzimmern der „Gemeinschaftsschulen“ und Berufsschulen passiert, lässt die parlamentarisch mandatierten und staatlich alimentierten Funktionsträger der „offenen Gesellschaft“ ziemlich kalt. Aber auch sie geraten ins Grübeln, wenn die eigene Lebenswelt, die höheren Schulen also und die Universitäten, betroffen zu werden droht.
Im Januar 2020 ist aber der Versuch, ein verfassungsrechtlich mögliches Gesetz zum Verbot der Vollverschleierung an den Bildungseinrichtungen Schleswig-Holsteins zu verabschieden, doch am Widerstand von „Bündnis 90/DIE GRÜNEN“ gescheitert: „Wer studiert, steht nicht vor Gericht“, sagte deren hochschulpolitischer Fraktionssprecher in Kiel. Das stimmt. Aber wer studiert, steht vor dem „Gerichtshof der Vernunft“, von dem Immanuel Kant – ein bekannter deutscher Philosoph des 18. Jahrhunderts – einmal gesprochen hat, und wer sich zu Hochschulangelegenheiten äußert, muss Vernunftgründe vorbringen können.
Das hat die Kieler Universitätsleitung versucht. Es ist ihr hoch anzurechnen, dass sie sich Gedanken darüber gemacht hat, ob eine Universität nicht doch mehr sein könnte als eine Apparatur für die möglichst zügige Verteilung von ECTS-Punkten.
Genützt hat es nichts. Denn was für zivilisierte Menschen selbstverständlich ist, ist es für unzivilisierte eben nicht, und da helfen auch keine vernünftigen Argumente. In kürzester Frist war 2019 nach dem Erlass der Richtlinie die allgemeine Mobilmachung gegen die Hochschulleitung abgeschlossen. Rund 200 Studierende, Dozierende und Mitarbeitende forderten in einem „Offenen Brief“ die Rücknahme der Richtlinie. Auch die Fachschaft des Masterstudiengangs „Migration und Diversität“ wandte sich dagegen. Dadurch erfuhr man nebenbei, dass man in Kiel „Migration“ studieren kann. Hier wird gelehrt, wie man sich in „Menschen mit Migrationshintergrund hineinfühlen“ und sich anschließend „optimal am Arbeitsmarkt durchsetzen“ kann.
Die „offene Gesellschaft“ und ihre neuen Feinde
Aber die Niqāb-Studentin in Kiel ist keine Migrantin. Sie ist, nach allem was man weiß, eine deutsche Konvertitin und wurde auf den schönen Namen „Katharina“ getauft. Das passt: In der katholischen Mythologie ist die Heilige Katharina die Schutzpatronin der Wissenschaftler und Universitäten.
Die Kieler Katharina ist nicht allein. Anders als ihre christliche Namenspatin, die Heilige Katharina von Alexandria, wird sie nicht als Märtyrerin verfolgt, gefoltert und hingerichtet. Die Kieler Katharina hat professionelle Helfer. Der Asta der Kieler Universität steht auf ihrer Seite. Er hat sich gegen den Beschluss der Universitätsleitung gewandt und in der gleichen Presseerklärung eine thematisch einschlägige Filmvorführung in „Kooperation mit der Roten Hilfe“ angeboten, einer vom Verfassungsschutz beobachteten linksextremistischen Vereinigung. Die Studentin selbst kündigt ihrerseits an, „bis zum Verfassungsgericht“ zu gehen, um ihr Grundrecht auf Religionsfreiheit durchzusetzen. Dabei wird sie unterstützt von der „Föderalen Islamischen Union e.V.“, die wiederum vom niedersächsischen Verfassungsschutz dem „politischen Salafismus“ zugerechnet und beobachtet wird.
Susanne Schröter, Frankfurter Ethnologie-Professorin und Leiterin des „Forschungszentrums Globaler Islam“, hat im vergangenen Jahr in ihrem Buch „Politischer Islam“ die Hintergründe und Strategien dieser Szene und ihrer willigen Vollstrecker ausgeleuchtet und dabei auch den gezielten Einsatz von Kopftuch und Verschleierung als Waffen im Kulturkampf beschrieben. Die Eroberung immer neuer Territorien der westlichen Gesellschaft durch den Islamismus, die Bernard Rougier gerade in seinem Buch „Les territoires conquis de l’islamisme“ so eindrücklich untersucht hat, dass auch Präsident Macron sie zur Kenntnis genommen hat, ist nicht nur ein Phänomen der Banlieues. Sie macht vor den Universitäten nicht halt, den französischen nicht und den deutschen auch nicht. Darum geht es.
Aber empirisch-soziologische Untersuchungen zum islamischen Fundamentalismus im akademischen Milieu gibt es nicht, auch nicht bei Rougier, und es wird sie so schnell nicht geben. Sie wären weder drittmittelträchtig noch karrierefördernd. Darauf den Blick zu lenken, blieb deshalb Michel Houellebecq mit seinem Roman „Soumission“ von 2015 vorbehalten. Immerhin zeigt der Roman, dass sich auch unter dem Halbmond ganz gut leben, lehren und forschen lässt, wenn man zu gewissen Arrangements bereit ist.
Die Wiederkehr des konfessionellen Bürgerkriegs
Dass ausgerechnet die Religionsfreiheit im Salafisten-, Kommunisten‑ und Postmigrantenmilieu eine solche Karriere machen würde, war nicht vorhersehbar. Aber im Kampf gegen die westliche Zivilisation sind alle Mittel recht, auch die wichtigsten Errungenschaften dieser Zivilisation selbst. Denn die „Religionsfreiheit“, eines der ältesten Grundrechte, ist eine Erfindung alter weißer Männer. Sie hat ihre Wurzeln in der Frühen Neuzeit und sie bezog sich auf das Binnenverhältnis der christlichen Konfessionen untereinander. Ihr Ziel war es, den konfessionellen Bürgerkrieg zu befrieden, was auf der Basis wechselseitiger Duldung auch einigermaßen gelungen ist. Heute hingegen wird die Religionsfreiheit dazu benutzt, neue konfessionelle Bürgerkriege anzuzetteln. Irgendwann sollten auch Verwaltungs‑ und Verfassungsrichter sich einmal die Frage stellen, ob hier nicht der Missbrauch eines Rechtsinstituts vorliegt.
In einem frühen Urteil zur Religionsfreiheit, dem etwas skurrilen „Tabaksbeschluss“ von 1960, hatte das Verfassungsgericht noch festgestellt, dass sich nur solche Überzeugungen auf die grundgesetzlich verbürgte Glaubens- und Bekenntnisfreiheit – wie die „Religionsfreiheit“ im Grundgesetz eigentlich heißt – berufen können, die in irgendeiner Weise „kulturädaquat“, also mit den Grundzügen der abendländischen Zivilisation vereinbar seien. Damals ging es um die Abwehr von Relikten nationalsozialistischen Neuheidentums.
Dieser „abendländische Kulturvorbehalt“, wie das Gericht es nannte, wurde in der Folgezeit stillschweigend fallen gelassen. Die um die Jahrtausendwende beginnende Serie von höchstrichterlichen Urteilen zur Religionsfreiheit bezog sich fast ausschließlich auf den Islam, allein zum Kopftuch im öffentlichen Dienst wurden von 2003 bis 2020 vier Beschlüsse gefasst. Hier hätte die Frage nach der „Kulturädaquanz“ leicht zu heiklen und politisch ungewollten Antworten führen können.
Hidschāb und die Unschuld der Wissenschaft
Aber außergerichtlich stellt sich schon die Frage, ob das Tragen einer Vollverschleierung in einer akademischen Einrichtung „kulturadäquat“ ist. Denn Schulen und Universitäten gehören ebenso wie das Gerichtswesen zu den empfindlichsten und verwundbarsten Stellen der westlichen Zivilisation. Die vollverschleierte Konvertitin Katharina aus Kiel ist ein eher bizarrer Ausnahmefall, der den Landtag unnötig in Aufregung versetzt hat. Ganz und gar kein Ausnahmefall ist hingegen die neue Generation gut ausgebildeter, bewusst kopftuchtragender Muslima an deutschen Universitäten. Sie finden sich auch und gerade in den Fächern, denen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der künftigen bundesrepublikanischen Gesellschaft zukommt – den Lehramtsstudiengängen und der Rechtswissenschaft. Hier bahnen sich Kulturkonflikte im oberen sozialen Segment der Gesellschaft an. Dabei macht es, anders als man in der politischen Diskussion gerne suggeriert, keinen Unterschied, ob diese Frauen ein Kopftuch oder eine Vollverschleierung tragen – Hidschāb bleibt Hidschāb.
Wenn minderjährige Schülerinnen durch elterlichen Zwang oder durch das inzwischen vielfach belegte Mobbing auf Schulhöfen zum Tragen eines Kopftuchs gezwungen werden, dann ist das etwas ganz anders, als wenn erwachsene Studentinnen ihr Kopftuch als Ausdruck ihrer Selbstbestimmung tragen. Bereits 2011 hatte die zuständige Modewissenschaftlerin der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität in der evangelischen Zeitschrift „chrismon“ erklärt, der Niqāb sei, nicht anders als das „kleine Schwarze“, Ausdruck von Individualität. Das ist zweifellos richtig oder zumindest nicht ganz falsch: Wer an deutschen Universitäten einen Niqāb oder ein Kopftuch trägt, will „ein Zeichen setzen“, wie man heute so sagt, und dieses Zeichen will gedeutet werden. Die Deutung ist einfach: Niqāb wie Kopftuch sind postrepublikanische Kleidungsstücke, Manifeste der Zugehörigkeitsverweigerung.
Die Kieler Katharina studiert, nach wie vor verschleiert, Ernährungswissenschaften. Welches Unheil, so könnte man fragen, kann eine, und sei es auch fundamentalistische, Muslima in einem so biederen Fach wie Ernährungswissenschaften schon anrichten? In einer Zeit jedoch, in der Ernährungsfragen wieder mit religiösen Tabus aufgeladen werden, in der Kulturkämpfe um Schweinefleisch in Kindergärten entbrennen, Halal-Angebote in Schul- und Universitätsmensen zur Selbstverständlichkeit geworden sind, ist selbst die Ökotrophologie kein unschuldiges Fach mehr.
Das gilt erst recht für andere Fächer. Vor drei Jahren wurden erste, empirisch noch unzureichend gestützte, Zweifel laut, ob muslimische Lehrerinnen bereit wären, die Evolutionstheorie im Biologieunterricht zu lehren. Über hochgradig ideologieanfällige Schulfächer wie Politik und Geschichte, Heimat- und Sachunterricht oder gar den „bekenntnisorientierten Religionsunterricht“ und das weite Feld der Rechtspflege muss man gar nicht erst reden.
Verbote helfen hier nicht weiter. Im Gegenteil: Die öffentlichen Einrichtungen, die Schulen und Universitäten, die Gerichte und Behörden, sollten das Tragen von Kopftüchern und Niqābs nicht nur erlauben, sondern dazu ermuntern. Dann kann sich jeder selbst ein Bild vom Stand der kulturellen Entwicklung in Deutschland machen.
Dieser Kulturkampf muss von denen ausgefochten werden, die noch eine Vorstellung haben davon, wofür Schulen und wofür Universitäten in einer westlichen Gesellschaft da sind.