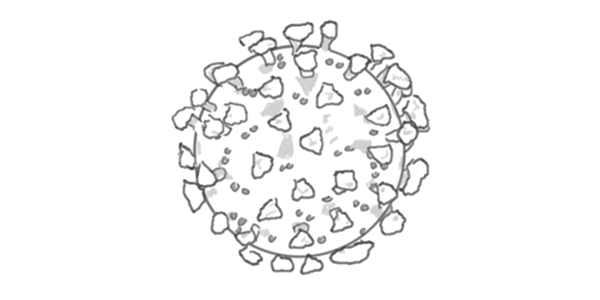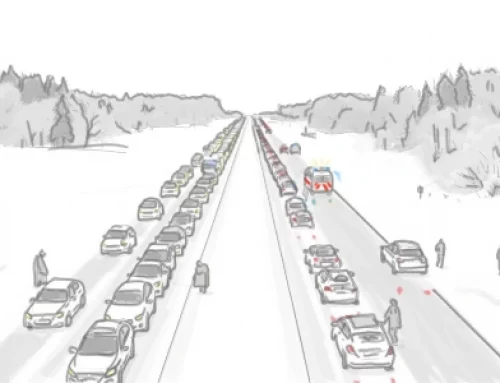Die Verdrängung der Wirklichkeit
Über Wochen hinweg wurde in der deutschen Öffentlichkeit die Corona-Krise wahrgenommen, als handele es sich um eine Netflix-Serie. Auch in den Qualitätsmedien, den öffentlichen wie den privaten, wurde die These vertreten, Corona sei eine Verschwörung des „rechten Spektrums“, das die „Angst vor dem Fremden“, in diesem Fall die Angst vor fremden Viren, schüren wolle. Aus der anderen, der nicht-rechten, Ecke kamen andere Befürchtungen: dass dunkle staatliche Mächte die Gelegenheit zur Einschränkung bürgerlicher und wirtschaftlicher Freiheiten missbrauchen werden. Der Verdacht wurde geschürt, der Staat könne sich zum Seuchenschutz der Daten bemächtigen, die man ansonsten nur Google und Facebook überlässt. Auch juristische Bedenkenträger melden sich zu Wort, von denen im September 2015 nichts zu hören war. Und dass irgendwie der amerikanische Präsident mit Schuld sein müsse, gehört zur deutschen Medienfolklore wie das Atmen.
So oder so: Es fiel der deutschen Öffentlichkeit schwer, die Bedrohung ernst zu nehmen. Ernst genommen wurde das Virus erst wirklich, als das Herzstück der Spaßgesellschaft, der Fußball, bedroht war, als über Schulschließungen diskutiert wurde und als Grenzkontrollen in die Diskussion kamen. Aber dem folgten die Corona-Partys der Spaßgesellschaft. Wer „jung und gesundheitlich nicht vorbelastet“ war, sah sich zu Grenzüberschreitungen jeder Art berechtigt. Der von der Fridays-for Future-Bewegung unter medialer Beihilfe geschürte, historisch beispiellose Generationenhass mit seinen Ausrottungs- und Vernichtungsphantasien trug jetzt seine giftigen Früchte.
Krisen seien die Stunde der Exekutive, pflegen Politologen zu sagen. Aber auf die Exekutive wartete man lange vergeblich. Nachdem die Bundeskanzlerin über Monate hinweg sich nicht mehr öffentlich geäußert hatte, nur einmal, am 3. März, mitten in der eskalierenden Corona-Krise, den Kampf gegen Rassismus als ihr „tiefstes Anliegen“ bezeichnete, musste man schon befürchten, das Volk habe das Vertrauen der Kanzlerin verloren.
Aber am 11. März kam das erlösende Wort: Die Bundeskanzlerin und ihr Gesundheitsminister setzen sich an die Spitze der Virusleugner-Bewegung und erklären Grenzschließungen und das generelle Verbot von Großveranstaltungen für unnötig. Stattdessen fordert die Bundeskanzlerin auf, „unser Herz füreinander“ zu entdecken. Fünf Tage später führte Deutschland Grenzkontrollen zu fünf seiner neun Nachbarländer ein. Am Tag darauf wurde ein Einreisestopp für alle Nicht-EU-Bürger beschlossen, ausdrücklich ausgenommen wurden Asylbewerber. Bayern kündigte die Schließung der Schulen und anderer Bildungseinrichtungen ab dem 16. März an; die meisten anderen Bundesländer schlossen sich dem an, während kurz zuvor noch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und andere Politiker sich gegen eine flächendeckende Schließung von Schulen gewandt hatten.
Zwei Reden: Merkel und Söder
Nach Wochen des Zauderns und Zögerns tritt die Bundeskanzlerin am 18. März für eine Fernsehansprache vor ihr Volk. Sie sagt nicht mehr als das, was sie zur Flüchtlingskrise auch gesagt hat: Die Virus-Krise ist nun mal da und die „Bürgerinnen und Bürger müssen sie als IHRE Aufgabe begreifen.“ Was sie nicht sagt, ist, was sie selbst als IHRE eigene Aufgabe und die der Regierung begreift. Sie sagt nicht, wie viele Plätze in Intensivstationen, wie viel Beatmungsgeräte, wie viele Atemmasken, wie viele Schutzanzüge, wie viel Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen oder woher sie kommen sollen und wann mit einem Impfstoff zu rechnen ist; sie sagt nicht, was genau die „staatlichen Ebenen“ planen, „um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen“. Sie sagt nichts über Grenz- und Schulschließungen, über Hilfen für die Wirtschaft und über die Ressourcen des Gesundheitssystems.
Selbst der nun wirklich überfällige Dank an die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in den Supermärkten kam in typischer Manier so verdruckst und verquer daher, dass kaum erkennbar wurde, was und wen sie eigentlich meinte. Und es war wohl kein Versehen, dass sie Polizisten und Grenzschützer, Feuerwehrleute und Ordnungskräfte aller Art zu erwähnen vergaß.
Am Tag darauf gab der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder eine Regierungserklärung im Landtag ab. Während die Bundeskanzlerin Abstandhalten, Händewaschen und Briefeschreiben als Königsweg aus der Krise empfohlen hatte, erklärt der Ministerpräsident in klaren Worten die administrativen, legislativen und wirtschaftlichen Maßnahmen der Landesregierung. Er erläutert die Folgen für die einzelnen Lebensbereiche, für die Bildungseinrichtungen, für das Gesundheitswesen, für Wirtschaft und Finanzen. Er kann berichten, dass die Staatsregierung 1 000 Beatmungsgeräte gekauft hat und dass mittelständische Betriebe auf Initiative der Staatsregierung mit der Fertigung von Schutzmasken begonnen haben. Und den Dank an die, die mithelfen, und zwar an alle, vergisst er auch nicht.
„So geht Führung“ jubelte die führende deutsche Boulevardzeitung. Aber sie meinte nicht den Ministerpräsidenten, sondern die Bundeskanzlerin. Ihr war es am 22. März 2020 gelungen, eine Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten der Bundesländer einzuberufen, sechs Wochen nach dem ersten deutschen Corona-Toten. Beschlossen wurden im Wesentlichen die gleichen Maßnahmen, die in Bayern schon Tage vorher eingeleitet wurden waren, und am Ende kommt heraus, was immer heraus kommt: „Kabinett beschließt Milliardenhilfen“, was in diesem Fall sogar richtig und notwendig ist.
Merkel wurde medial umjubelt, nachdem sie wochenlang nichts getan hatte, Söder wurde attackiert, weil er halbwegs rechtzeitig getan hatte, was zu tun war. So geht nicht Führung, aber so geht Politik. Ob das der deutschen Bevölkerung nützt, weiß man nicht; aber der Kanzlerin nützt es, das zeigen die Umfragewerte. In der deutschen Erlebnisgesellschaft zählt pastoraler Politkitsch eben mehr als kühler Sachverstand und klares Verwaltungshandeln.
Das Ende der alten Gewissheiten
Wie so oft, so beschwor auch diesmal die Bundeskanzlerin die Solidarität, die Gemeinschaft, das gemeinsame Handeln. Aber Deutschland ist nicht China. Diese Gesellschaft wird sich durch Fernsehappelle einer Bundeskanzlerin nicht zusammenführen lassen, und das ist auch nicht die Aufgabe der Regierung. Der Staat muss die Sicherheit seiner Bürger garantieren, und er muss die Infrastruktur für die Grundversorgung mt lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen sicherstellen. Für ihren Zusammenhalt muss die Gesellschaft schon selber sorgen.
In der Corona-Krise werden einige Lebenslügen dieser Gesellschaft in Frage gestellt. Speziell die Deutschen werden wieder lernen müssen, dass moderne Gesellschaften nur dann funktionieren, wenn sie diskriminieren – wenn sie Unterscheidungen vornehmen zwischen Kranken und Gesunden, Infizierten und Nicht-Infizierten, Staatsbürgern, die auf Staatskosten aus dem Urlaub zurückgeholt werden – der Bundesaußenminister stellte dafür 50 Millionen Euro bereit – und Nicht-Staatsbürgern, für die das nicht gilt. Es gibt Unterscheidungen zwischen unverzichtbaren „systemkritischen“ – gemeint sind wohl „systemstabilisierende“ – und nicht so wichtigen Berufen; zwischen Politikern, die prophylaktisch auf Corona getestet werden, und normalen Bürgern, für die keine Tests zur Verfügung stehen. In der Wohlstands- und Spaßgesellschaft, die sich gerne mit Sekundärproblemen befasst, kann man solche notwendige Unterscheidungen – „Diskriminierungen“ – lange verdeckt halten oder gar als „strukturellen Rassismus“ ächten. In Zeiten der Krise treten sie zutage und erweisen sich als überlebensnotwendig.
Dass die Politik einer hemmungslosen wirtschaftlichen Globalisierung und ihre humanitäre kleine Schwester, die Politik der offenen Grenzen, an ihr Ende gekommen sind, dürfte selbst dem abgebrühtesten Wirklichkeitsverächter klar geworden sein. Auch die Umwelt- und Klimadiskussion wird einige ihrer Lebenslügen verabschieden müssen: Der öffentliche Nah‑ und Fernverkehr, der in der Klimakrise als ultimative Mobilitätslösung propagiert wurde, wird plötzlich zur Virenschleuder. Unversehens wird auch klar, dass die Regale in den Supermärkten von dieselgetriebenen LKWs beliefert werden, denen man verschämt Sonderspuren an den Grenzübergängen freimacht. Plastikfolien gewinnen als Hygieneschutz neues Prestige, und die Chemie-Industrie wird wieder hofiert, weil man ihre Desinfektionsmittel und Impfstoffe braucht. Vielleicht ahnt man auch, was es bedeuten könnte, wenn der Ausfall von Strom‑ und Wärmeversorgung wegen aufgelassener Atom- und Kohlekraftwerke und unzuverlässiger Wind- und Sonnenenergie nicht mehr nur eine fernes Gedankenspiel aus dem „rechten Spektrum“, sondern denkbare Realität wird.
Aus der Krise kann man lernen, dass man mit ideologisch motivierten dogmatischen Vereinseitigungen gesellschaftliche Handlungsspielräume verengt und abschneidet, die man in Krisenzeiten – und nicht nur dann – dringend benötigt.
Verborgene Erinnerungsschätze
Die Schulen und die Medien täten gut daran, die Erinnerung daran nicht einschlafen zu lassen, wie frühere Gesellschaften mit Krisen dieser Art umgegangen sind. Niemand wünscht sich, dass die nächste Generation die Erfahrung der Krisen vergangener Jahrhunderte, die Erfahrung von Seuchen, Hunger, Inflation; von Vernichtungslagern, Krieg, Vertreibung, Zerrüttung gesellschaftlicher Verhältnisse je einmal selbst machen muss. Hier ließe sich viel aus der Geschichte lernen, wenn man dazu bereit wäre.
Die Weltliteratur, als die kultivierte Kehrseite der Globalisierung, hat einige von diesen Erfahrungen festgehalten. Boccaccios „Decamerone“ erzählt in 100 Geschichten, wie zu Beginn der Neuzeit die gleichermaßen verheerende wie kulturprägende und zivilisationsstiftende Macht der Schwarzen Pest soziale Extreme hervorruft, von Bußexzessen bis zu frivolen Ausschweifungen. Daniel Defoe zeigt in seinem fingierten, aber in seiner statistischen Nüchternheit umso eindringlicheren „Journal of the plague year“, wie die neuzeitliche Gesellschaft zu lernen beginnt, mit der großen Pest umzugehen. Bei Edgar Allan Poe wird die Cholerapandemie der 1830er Jahre – der noch Hegel zum Opfer fiel – zum literarischen Geburtsort einer morbiden „Ästhetik des Schreckens“. Karl May, der begnadete Erzähler, gibt im dritten Band seines Orient-Zyklus „Von Bagdad nach Stambul“ eine der eindringlichsten Darstellungen der Pest, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wieder ausbreitete, und deutet sie als Folge orientalischen Zivilisationsrückstandes. Thomas Mann schließlich holt die Seuchen seiner Zeit wieder in den bürgerlichen Alltag hinein: den Typhus in den „Buddenbrooks“, die Cholera im „Tod in Venedig“ und die Tuberkulose im „Zauberberg“. Der Corona-Krise chronologisch wie sachlich am nächsten steht der Klassiker dieser Motivtradition: Albert Camus‘ „La Peste“ von 1947.
Die Erfahrung epidemischer Krankheiten und ihrer Folgen ist also wahrlich nicht neu. Sie ist nur vergessen. Die historische Erinnerung könnte das Bewusstsein dafür wach halten, dass das Unvorhersehbare jederzeit eintreten kann, dass das Unwahrscheinliche nicht das Unmögliche und dass die Katastrophe nicht undenkbar ist.