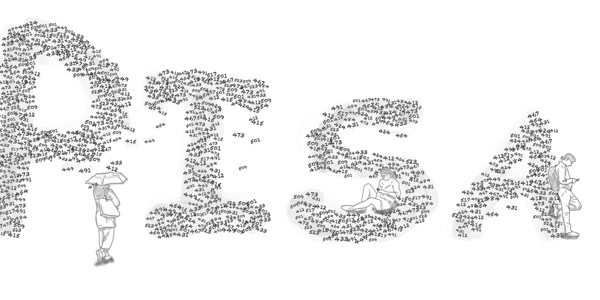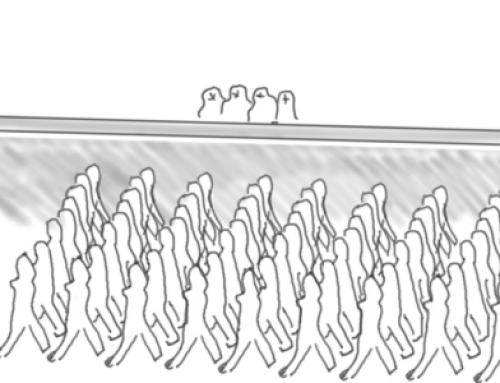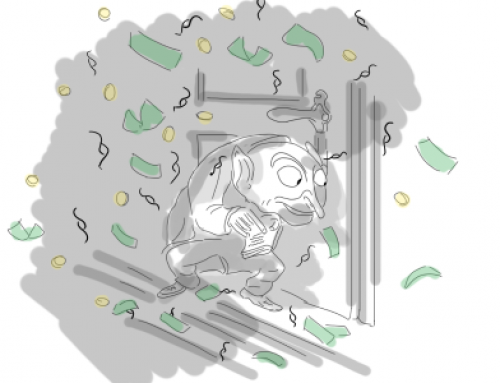Bildungsforschung in der Endlosschleife
Das Ritual
Am 3. Dezember 2019, um 9:00 morgens, war es wieder so weit: In einer dpa-Meldung wurde, zum siebten Mal seit 2001, mitgeteilt, dass sich die Leistungen der deutschen Schüler verschlechtert hätten. Das war jedenfalls der Befund der „internationalen Schülerleistungsvergleichs-Studie“ der OECD, Pisa 2018. Wieder wurde ein seit 2001 gut eingespieltes Ritual durchexerziert: Die deutsche Presseagentur gab, den Einflüsterungen des Pariser OECD-Koordinators Andreas Schleicher folgend, die Deutungsrichtlinie vor und die deutschen Leitmedien, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vornweg, die „Redaktionsnetzwerke“ und Pressestellen der Kultusministerien verbreiteten im Anschluss die Botschaft bis zur letzten Provinzzeitung.
In der Summe kommt die Studie zu einem klaren Befund: „Die Ergebnisse der aktuellen PISA-Erhebungsrunde machen für Deutschland Stärken und Schwächen deutlich.“ (S. 106) Müssen Bundesbildungsministerium und Kulturministerkonferenz wirklich 1,5 Millionen Euro pro Jahr – von den versteckten Kosten ganz zu schweigen – ausgeben, um das herauszufinden? Aber die Pisa-Studien leben nicht vom Erkenntnisgewinn, sie leben von der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und öffentliche Aufmerksamkeit erzielt man durch Skandale. Da hat man sich diesmal etwas schwer getan. Denn diese siebte Pisa-Studie hatte das Unglück, mit den Klimarettern konkurrieren zu müssen, die sich gerade zur „25. Weltklimakonferenz“ in Madrid versammelt hatten. Und der Skandal, den auch die aktuelle Studie pflichtgemäß verkündete, ist nicht mehr taufrisch: „Die Ergebnisse der PISA-Studie 2018 zeigen erneut, dass im Vergleich zu anderen OECD-Staaten der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Lesekompetenz in Deutschland besonders stark ausgeprägt ist“, heißt es im besten Pisa-Deutsch. (S. 158) Höchste Weihen erhält dieser Befund am nächsten Tag durch den Bundespräsidenten, dessen SPD-Mitgliedschaft amtsbedingt zurzeit ruht. Er sagte im Alltagsdeutsch, was zu jedem Pisa-Test zwingend gesagt werden muss. „In Deutschland entscheidet noch immer häufig die soziale Herkunft über die Bildungschancen von Kindern.“ Kurz: Deutschlands Schulsystem ist ungerecht.
„Lesekompetenz“: Was wird erforscht?
Die Pisa-Studien untersuchen jeweils drei schulische Lernbereiche, „Domänen“ genannt, nämlich Lesen, Mathematik und „naturwissenschaftliche Bildung“. Bei Pisa 2018 wurde schwerpunktmäßig die „Lesekompetenz“ erhoben. Wie genau das gemacht wurde, ist schwer nachvollziehbar, denn die Pisa-Studien entziehen sich systematisch dem wissenschaftlichen Diskurs, indem sie die Testaufgaben geheim halten. Immerhin wurden auch dieser aktuellen Studie zwei „Aufgabeneinheiten“ als Beispiele beigegeben. Eine handelte von einem simulierten Internetforum über aspirinfressende Hühner, die andere von Umweltproblemen auf den Osterinseln. Mit etwas guten Willen kann man zugestehen, dass diese Aufgaben die Fähigkeit testen, Informationen aus Texten zu entnehmen. Tatsächlich erhebt die Pisa-Studie, allem Kompetenzstufenkauderwelsch zum Trotz, auch keinen anderen Anspruch: Wer einem Text Informationen entnehmen kann, bekommt Pisa-Punkte, und wer ganz „tief eingebettete“ Informationen herausfindet, bekommt noch mehr Punkte und ist Pisa-Sieger. Besonders stolz sind die Pisa-Forscher darauf, dass die Test-Schüler neuerdings nur noch mit der Computermaus hantieren müssen: „Insbesondere sind Markieren und Drag-and-Drop-Formate neue Instrumente, um Lesekompetenzen zu erfassen.“ (S. 42)
Mit Lesen hat das alles wenig zu tun, und mit Sprachbeherrschung, zu der auch das Schreiben und Sprechen gehören, noch weniger. Denn „Sprache“ ist mehr als Verschlüsselung und Entschlüsselung von Informationen; Sprache hat kommunikative und diskursive, emotionale und soziale, ästhetische und rhetorische und vor allem auch politische Facetten. Davon weiß Pisa aber nichts. Am Ende erforscht Pisa nur sich selbst, eine Sprachkompetenz, die es nur im Pisa-Kosmos gibt.
Was kann man tun?
„Lesen – das ist spätestens seit PISA 2000 klar – stellt in einer literalen, also schriftbasierten Gesellschaft eine unabdingbare Schlüsselqualifikation dar“, teilen die Pisa-Forscher mit. (S. 21) Außerhalb des Kosmos der Pisa-Forscher weiß man das aber nicht erst „seit PISA 2000“. Man weiß es seit der Schulreform Wolfgang Ratkes von 1612, in der die Muttersprache Deutsch als vollwertiges Schulfach in den Lehrplan aufgenommen wurde. Sprachfähigkeit ist das Fundament aller Erziehung und aller Bildung.
Wenn die aktuelle Studie nun herausgefunden hat, dass ein Fünftel der deutschen Schüler nicht einmal den schlichtesten Pisa-Anforderungen an Lesefähigkeit entsprechen, dann ist das in der Tat ein Alarmzeichen. Es muss etwas getan werden. Die Pisa-Studien haben die bildungswissenschaftliche Sachkundeschwelle so weit abgesenkt, dass inzwischen jeder glaubt mitreden zu können. Auch in der letzten Provinzzeitung – so in dem im nordbayerischen Weiden erscheinenden „Neuen Tag“ – weiß man, was getan werden muss. Man müsse doch nur, so versichert die Kommentatorin am Tag nach Pisa treuherzig, „bei den Top-Ländern wie Finnland spicken“. Aber die Problemlagen der deutschen Schule sind andere als die in Finnland. Auch den Pisa-Autoren ist nicht verborgen geblieben, dass das unerfreulich schwache Abschneiden in der „Domäne“ Lesekompetenz etwas mit der Zuwanderung zu tun haben könnte, und mit großem Erstaunen stellen sie fest, dass Kinder, in deren Familien nicht oder kaum Deutsch gesprochen wird, schlechte Lesefertigkeiten haben. „Bei PISA 2018 ist der Anteil der Fünfzehnjährigen mit Zuwanderungshintergrund in Deutschland (36 %) im Vergleich zu PISA 2009 (26 %) noch einmal gestiegen“. (S. 124) Und diese Zahlen sind noch geschönt: Sie erfassen nur Schüler, die selbst oder deren Eltern zugewandert sind. Die integrations- und damit schulpolitisch oft besonders problematische dritte oder gar vierte Generation der Zugewanderten geht in diese Statistik nicht mehr ein, ebenso wenig wie die Schüler, die weniger als ein Jahr lang Deutschunterricht hatten.
Die „Handlungsempfehlungen“ (S. 188) der aktuellen Pisa-Studie münden in einem wegweisenden Ratschlag: „Die vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen, dass weitere Bemühungen im schulischen und außerschulischen Bereich in Deutschland nötig sind, um die Lesemotivation sowie die Lesemenge der Kinder und Jugendlichen gezielt zu fördern.“ (S. 107) Aber das Erlernen der Landes- oder Muttersprache ist kein technischer Vorgang, den man nach Belieben steuern könnte. Es ist ein sozialer Prozess, der tief eingewurzelt ist in familiären und sozialen Verhältnissen, und die ändern sich so schnell nicht.
Wo wird das enden?
Es ist absehbar, dass der Anteil von Schülern nichtdeutscher Muttersprache bald bei weit über 50% liegen wird. Während jetzt Türkisch, Arabisch, Russisch, Kurdisch, Albanisch sowie aus der EU-Binnenwanderung Rumänisch und Bulgarisch die Hauptkonkurrenten des Deutschen auf den Schulhöfen und in den Klassenzimmern sind, kommen die Sprachen aus den neuen Haupteinwanderungsländern neu hinzu: Paschti, Tigrinya, Farsi, Englisch, Somali und Französisch. Wie die Schulen und Schulpolitiker reagieren werden, ist längst abzusehen. Man lässt die Dinge treiben, sei es aus politischer Opportunität oder sei es aus Einsicht in die Aussichtslosigkeit aller Maßnahmen. Der „Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan“ für Kinder im Vorschulalter propagiert bereits seit langem „das Zusammenleben verschiedener Sprachen“ als „Selbstverständlichkeit“ und gibt damit das Minimalziel gemeinsamer landessprachlicher Sprachkompetenz von vornherein auf. In Hamburg und etlichen anderen Bundesländern machen Schulen ein „herkunftssprachliches Unterrichtsangebot“ in Türkisch und Arabisch, Farsi/Dari wird erprobt, es gibt Unterricht in Aramäisch und Paschtu, um die Chancengleichheit zu sichern. Zur „Stärkung der kulturellen Identität“ können Schüler zudem Türkisch, Russisch oder Polnisch als zweite Fremdsprache – die aber faktisch die Muttersprache ist – wählen, und bayerischen Grundschülern nichtdeutscher Muttersprache wird unter bestimmten Bedingungen bei der Notenberechnung für den Übertritt zum Gymnasium ein Bonus gewährt.
Angesichts dieses babylonischen Sprachenwirrwarrs in deutschen Klassenzimmern wird sich die Prophezeiung der Sprachwissenschaftler bald erfüllen, dass aus der Landes- und Kultursprache Deutsch eine „Vernakularsprache“ wird, eine langsam schwindende Sprachvarietät, die nur noch die Ureinwohner beherrschen. Nicht jeden bedrückt das. Die „erfolgreiche sprachliche Koproduktion“ multiethnisch zusammengesetzter Jugendgruppen wird inzwischen von Lehrern, Erziehungswissenschaftlern und Journalisten als kreativer Prozess bejubelt. Die zusehends stärker propagierte „Leichte Sprache“ wird bald die Rolle der lingua franca übernehmen, als rudimentäres „Interlanguage“-Angebot für Zuwandererkinder. Die anderen hingegen, die in ihren Schüleraustauschprogrammen, den Auslandssemestern und Gap Years das sterile Weltenglisch der globalen Eliten erlernt haben, werden ihre Muttersprache nicht mehr benötigen.
Auch wenn die Pisa-Studien großflächig an den eigentlichen Problemen des deutschen Schulwesens vorbeiforschen, so kann man dem Befund doch zustimmen, dass es sich in einem beängstigenden Zustand befindet. Es ist an der Zeit, dass sich die deutschen Schulen den Problemen widmen, die sie wirklich haben, und nicht denen, die ihnen von Pisa eingeredet werden. Aber das erforderte bildungs-, sozial- und migrationspolitische Entscheidungen, die wenig populär wären.