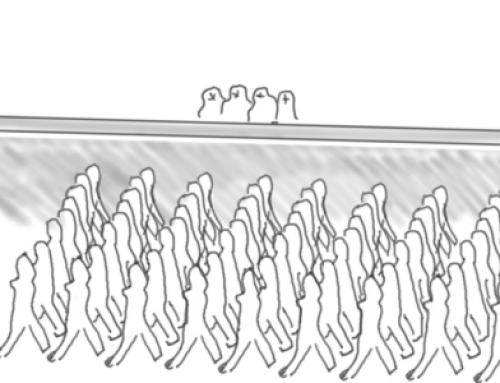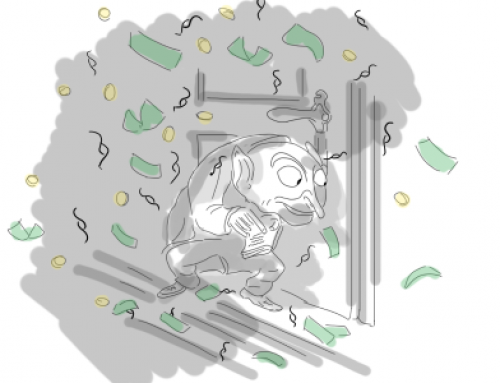Der Rechtsstaat
„Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande?“ – diese Frage stellte der heilige Augustinus, einer der bedeutendsten Vordenker des Abendlandes, in seinem Buch über den „Gottesstaat“, das er unter dem Eindruck der Eroberung und Plünderung Roms durch die Westgoten im Jahre 410 schrieb.
Es hat viele Jahrhunderte gedauert, bis es zumindest in Europa so weit war, dass sich die Territorien über den Status einer Räuberbande hinaus erhoben und sich eine rechtsstaatliche Gestalt gaben. Was Augustinus aber noch nicht im Blick haben konnte, war die interessante Frage, was es denn mit einem Staat auf sich habe, in dem es nicht zu wenig, sondern zu viel Recht gibt. In Deutschland könnte dieser Zustand jetzt langsam erreicht werden. Aktuell gibt es 1700 Bundesgesetze. Der Bundestag hat im Jahr 2023 228 Gesetze verabschiedet; im Jahr zuvor waren es 115, dabei sind Landesgesetze, das Europäische Recht und das Völkerrecht noch nicht berücksichtigt.
Nun könnte man annehmen, dass die Vielzahl der Gesetze der beste Beleg für den Rechtsstaatscharakter der Bundesrepublik sei. In der Tat hält Deutschland sich viel zugute darauf, ein „Rechtsstaat“ zu sein. Aber man kann einen deutschen Juristen leicht in Verlegenheit bringen, wenn man nach den Bestimmungsmerkmalen dieses Begriffs „Rechtsstaat“ fragt. Auch das deutsche Grundgesetz hält sich zurück; an verstreuten Stellen spricht es von „rechtsstaatlichen Grundsätzen“, hütet sich aber vor einer genaueren Definition.
Vom Rechtsstaat spricht man in Deutschland schon seit der Zeit um 1800. Gemeint war damit einfach, dass es ein geltendes Recht gab, das einigermaßen mit dem Rechtsempfinden der Bürger übereinstimmte, und dass sich der Bürger auf dieses Recht verlassen konnte; das implizierte ein Willkürverbot und das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Dass aber ein Rechtsstaat demokratisch sein oder gar für Gerechtigkeit sorgen müsse, gehört nicht zu den althergebrachten „rechtsstaatlichen Grundsätzen“. Vielmehr war das Recht im vordemokratischen Rechtsstaat nach modernem Verständnis eindeutig ungerecht. Es bevorzugte die einen und benachteiligte die anderen. Der Rechtsstaat muss also keine Demokratie sein, und erst recht muss es kein gerechter Staat sein.
Zuviel Recht
Aber eine Leistung muss der Rechtsstaat zwingend erbringen: Er muss seinen Bürgern sagen können, welches Recht gerade gilt, was von ihnen erwartet wird und worauf sie sich verlassen können. Die Antwort auf diese Fragen ist immer verschwommener geworden. Die Europäische Union hat dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet. Seit Jahrzehnten wird deutsches Recht, auch das deutsche Grundgesetz, vom Recht der Europäischen Union nicht etwa einfach abgelöst, sondern überwölbt, sodass in vielen Bereichen zwei Rechtssysteme nebeneinander existieren. Politik und Verfassungsgericht haben das Problem mit verfassungsfremder Brachialgewalt gelöst: Im Konfliktfall gilt europäisches Recht, obwohl allgemein anerkannt ist, dass es demokratisch weniger legitimiert ist als das nationale Recht.
Inzwischen ist diese Entwicklung im Zentrum der deutschen Lebenswirklichkeit angekommen. Elementare Lebensverhältnisse werden von EU-Verordnungen und EU-Richtlinien einschneidend geregelt. Unübersehbar wurde das mit dem Asylrecht, in dem genuin deutsches Recht fast keine Rolle mehr spielt. Im Asylrecht hat sich neben dem grundgesetzlichen Asylanspruch ein Wirrwarr von – je nach Zählung – acht bis zehn asylähnlichen Bleiberechtsregelungen entwickelt, von denen die wenigsten eine Grundlage im deutschen Recht haben und von denen nur ein Bruchteil sich auf Art. 16 GG berufen kann. Seit 2011 gibt es die freischwebende Erfindung des „subsidiären Schutzes“, der eine fast beliebige Auslegung ermöglicht und der keineswegs ein Grundrecht ist, sondern auf der EU-Richtlinie 2011/95/EU beruht. Sodann folgt eine Fülle von Sonder- und Ausnahmeregelungen, die durch Urteile des „Gerichtshofs der Europäischen Union“ (EuGH) und des „Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte“ (EGMR) bis zur Unkenntlichkeit weiter ausdifferenziert werden. Ähnliche Entwicklungen bahnen sich in der Klimaschutzgesetzgebung an.
Und neben dem EU-Recht gibt es noch das Völkerrecht. Das Völkerrecht genießt bekanntlich hohes Ansehen in Deutschland, und der deutschen Außenministerin wird nachgesagt, dass sie es sogar studiert habe. Aber was genau im Völkerrecht festgelegt wird, weiß niemand so richtig, wahrscheinlich auch die Ministerin nicht. Denn Völkerrecht ist zum guten Teil Gewohnheitsrecht, aus dem man sich je nach Interessenlage und Machtverhältnissen heraussuchen kann, was einem passt. Und erst recht kann sich jedes Land selbst entscheiden, ob es sich daran hält oder nicht, denn wirksame Sanktionsmechanismen jenseits der öffentlichen Ächtung gibt es kaum.
Aber auch damit noch nicht genug: Was in der deutschen Öffentlichkeit und selbst in der juristischen Fachdiskussion noch kaum beachtet wird, ist das immer stärkere Vordringen eines internationalen „soft law“ in die deutsche Politik und die Rechtsprechung. Das „soft law“ besteht aus Resolutionen, Deklarationen, Leitlinien, Absichtserklärungen, die allesamt keine rechtliche Bindekraft haben, die sich aber zur Rechtfertigungsgrundlage für weitreichendes politisches Handeln verfestigen können, ohne dass sie je in einer fassbaren Form kodifiziert worden wären. Die Diskussion über die Rückgabe von „Raubkunst“ war ein erster, öffentlich breit wahrgenommener Versuchsballon zur Umsetzung von „soft law“ in einem politischen Randgebiet; ihm folgte der wesentlich brisantere UN-Migrationspakt von 2018, und es ist abzusehen, dass sich ihm bald ein WHO-Gesundheitspakt anschließen wird.
Der Rechtsstaat und seine Bürger
Ein Rechtsstaat ist ein Staat, der sich seinen Bürgern kaum bemerkbar macht und der nur dort eingreift, wo es zwingend nötig ist. So war es auch bis vor rund einem Jahrzehnt in der Bundesrepublik Deutschland. Wer als Normalbürger nicht gerade einen Nachbarschaftsstreit vor Gericht ausfocht oder Widerspruch gegen einen Bußgeldbescheid einlegte, konnte sein gesamtes bürgerliches Leben verbringen, ohne je mit einem Gericht in Berührung zu kommen. Denn der historisch gewachsene Rechtsstaat beruht auf Regeln, die jedem autochthonen Bürger intuitiv verständlich waren, weil sie ihm durch Sozialisation und Einsichtsfähigkeit vermittelt wurden und an die er sich auch unter normalen Umständen hielt. Die Vorstellung, dass man straffällig werden könnte, weil man sich auf eine Parkbank setzte, beim Spazierengehen weniger als 1,5 Meter Abstand hält oder eine nicht staatskonforme Heizung eingebaut hat, war diesem alten Rechtsstaatsverständnis fremd.
Aber die Zeiten ändern sich, und vor allem: Sie ändern sich schnell, oft so schnell, dass das Recht nicht mehr hinterherkommt, sodass entweder Gesetzeslücken entstehen oder aber hastig zusammengestoppelte Gesetze erlassen werden. Je größer der Transformationseifer der Regierung und der sie tragenden Parlamentsfraktionen ist, desto größer wird das Bedürfnis, immer neue Gesetze zu schaffen.
Dass die neuen Gesetze immer eigenartiger werden, ist unter diesen Umständen nicht überraschend. Das „Gute-Kita-Gesetz“ konnte man als gutmütiger Staatsbürger von der humoristischen Seite nehmen. Das gilt schon weniger für Gesetze, deren Namensgebung bereits den Wunsch verrät, dass sie Dinge leisten möchten, die sie nicht leisten können: „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden“ – aber Gesetze sparen keine Energie ein; sie können höchstens die Bürger dazu zu zwingen versuchen, das zu tun; es gibt ein „Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases“, das in Wahrheit auf den zügigen und massiven Abbau von Naturschutzvorschriften zielt. Die Gesetzbegeber dürfen sogar annehmen, dass sie mit diesen Gesetzen eine Politik vorantreiben, die von der Bevölkerungsmehrheit gewollt ist – so lange jedenfalls, bis die Bürger merken, dass sie selbst gemeint sind, ihr eigener Heizungskeller und ihre Natur vor der Haustüre.
Vertrauen
Der Rechtsstaat braucht das Vertrauen seiner Bürger. Das wissen auch die Gerichte. Hin und wieder hat das Bundesverfassungsgericht in jüngerer Zeit beiläufig darauf hingewiesen, dass Gerichtsurteile das „allgemeine Rechtsempfinden und das Vertrauen der Bevölkerung in die Unverbrüchlichkeit des Rechts“ auch in Betracht ziehen sollten. Es ist nun einmal so, dass sich nicht nur ein Parlament und eine Regierung, sondern auch die Justiz das Vertrauen der Bevölkerung erwerben muss. Mit seiner irrlichternden Gesetzgebung und ihren vielen Grauzonen macht es der Gesetzgeber der Justiz nicht leicht, aber auch sie selbst hat ihren Anteil am zunehmenden Misstrauen der Bürger gegenüber dem Rechtsstaat.
In jüngerer Zeit haben die Verwaltungsgerichte neue Bedeutung gewonnen. Normalerweise befassen sich Verwaltungsrichter mit wenig aufregenden Themen, Alltagskonflikten zwischen Bürger und Staat. Aber gerade in dieser Alltagsbezogenheit sind sie ein wesentlicher Teil der deutschen Gerichtsbarkeit. Mit der Flüchtlings- und der ihr folgenden Coronakrise sind die deutschen Verwaltungsgerichte in den Blick der Öffentlichkeit geraten. Allein im Jahr 2021 waren 105 618 Asylverfahren vor den Verwaltungsgerichten und 8174 Verfahren vor den Oberverwaltungsgerichten anhängig. Dabei hat sich eine Rechtsprechungspraxis eingependelt, die mit ihren Duldungsbescheiden und Abschiebehindernissen für Außenstehende nicht mehr nachvollziehbar ist, aber politischen Wunschvorstellungen entspricht und hohe gesellschaftliche oder zumindest mediale Akzeptanz findet. Nicht anders verhält es sich mit der Verwaltungsgerichtsrechtsprechung in der Corona-Zeit. Es ist schwer vorstellbar, dass die deutschen Verwaltungsgerichte ihre auf sandigen juristischen Grund gebauten Corona-Urteile gefällt hätten, wenn sie nicht auf eine breite Zustimmung bei der Bevölkerung hätten rechnen dürfen.
Am anderen, dem oberen Ende der Hierarchie steht das Bundesverfassungsgericht. Während die Verwaltungsgerichte mit ihrer Rechtsprechung dem Alltag ganz nah sind, ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dem Alltag weit entrückt. Ihm ist es in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik gut gelungen, das Vertrauen der Bürger zu erwerben. Ob das so bleiben wird, muss sich noch zeigen. Naturgemäß bewegen sich die Richter des Bundesverfassungsgerichtes in Grenzgebieten des Rechts, und oft genug müssen sie diese Grenzen überschreiten und neues Recht schaffen, weil das positive Recht für die zu entscheidenden Fälle oder für neue politische Entwicklungen nicht ausreicht. Das ermuntert die Richter oft dazu, selbst Recht zu schöpfen – zu oft, sagen Kritiker: Der Konstanzer Rechtstheoretiker Bernd Rüthers hat vor der Umbildung des „Rechtsstaats“ zu einem „Richterstaat“ gewarnt, einem Richterstaat, so kann man inzwischen hinzufügen, in dem politische Opportunitätserwägungen immer häufiger die Oberhand gewinnen gegenüber grundgesetzlich fundierten Abwägungen. Seit Jahrzehnten bewegt sich das Bundesverfassungsgericht mit seiner Euro- und EU-Rechtsprechung auf diesem schmalen Grat zwischen verfassungsrechtlichen und politischen Erwägungen. Mit seiner Corona-Rechtsprechung und seinem Klimaurteil, dessen Begründung unverkennbar nicht nur juristische, sondern auch verheerende intellektuelle Defizite aufweist, gibt das Gericht sich erst gar nicht mehr die Mühe, seinen politischen Gestaltungsehrgeiz, der sich mit der Volksstimmung eins weiß, zu bemänteln.
Das tut man nicht
Die Bürger und Staat haben ein Abkommen: Der Staat gewährt Rechtssicherheit, und die Bürger versprechen Verhaltenssicherheit. In historisch gewachsenen Gesellschaften kann sich der Staat auf fundamentale Grundsätze bürgerlicher Lebensführung verlassen, die in generationenlangen Sozialisationsprozessen eingeübt und weitergegeben werden, ohne dass der Gesetzgeber sie formulieren und die Justiz eingreifen müsste: „Das gehört sich nicht“, „das tut man nicht“; „das sagt man nicht“. Zu den sozialen Verhaltensnormen gehören durchaus auch Abweichungen von den Rechtsnormen: „Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden“, schrieb Kant 1784. Daran hat sich nichts geändert. Dass Menschen sich nicht immer an Verkehrsregeln halten, weiß man, und dass sie Eigentums- oder Körperverletzungsdelikte begehen, ist rechtswidrig, kommt aber vor. Darauf ist das Rechtssystem eingestellt.
Wenn diese Verhaltenserwartungen von einer großen und wachsenden Gruppe in der Bevölkerung aufgekündigt werden, so dass nicht nur ausnahmsweise, sondern seriell die Justiz korrigierend eingreifen muss, dann ist das Rechtssystem am Ende. Es ist ein hoffnungsloses Unterfangen, auch nur die Äußerungsdelikte in den sozialen Medien juristisch bändigen zu wollen in einer Zeit, in der die Lust an Beleidigungen ebenso zunimmt wie die Empfindlichkeit der Diskursteilnehmer. Die wehrhafte Spitzenpolitikerin ausgerechnet einer liberalen Partei rühmt sich, allmonatlich 250 Strafanzeigen wegen „Hass und „Hetze“ bei der Justiz einzureichen. Hier stimmt auf beiden Seiten etwas nicht: bei der Justiz, die keinen Rechtsmissbrauch erkennen kann, und bei der Antragstellerin, die in ihren langen Lebensjahren offensichtlich immer noch nicht gelernt hat, dass es aus dem Wald so herausschallt, wie man hineinruft. Mit der Justiz sind diese neuen gesellschaftlichen Problemlagen nicht zu bewältigen; da helfen auch kein „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ und kein „Digital Services Act“. Hier wird die bürgerliche Gesellschaft ihre eigenen Verhaltensstandards den neuen medialen Gegebenheiten anpassen müssen.
Aber die eigentlichen Herausforderungen für den Rechtsstaat sind ganz andere. Der Gesetzgeber hat nicht damit gerechnet und auch nicht damit rechnen müssen, dass Einzelhandelsgeschäfte vor den Augen ihrer hilflosen Besitzer bandenmäßig ausgeraubt werden. Erst recht ist im Rechtssystem nicht vorgesehen, dass Menschen ohne erkennbaren Grund auf offener Straße mit einer Machete ermordet werden oder dass am helllichten Tag Massenvergewaltigungen im öffentlichen Raum stattfinden. Solche Fälle sind juristisch nicht mehr fassbar. Die Richter geben sie deshalb gerne an die Psychiatrie ab, nachdem sie vorher so getan haben, als würden sie ernsthaft überlegen, ob man ein solches Verhalten nicht doch als normal und die Täter als schuldfähig betrachten müsse.
In einer Gesellschaft, in der das Recht seine Geltung verloren hat, gilt dann wieder das Wort des heiligen Augustinus vom Staat, der nichts Besseres ist als eine große Räuberbande.
***
Das Internetradion „Kontrafunk“ sendet jeden Freitag einen Beitrag aus der Reihe „Der Rechtsstaat“, in dem Rechtsfälle und Rechtsfragen in Interviews und Kommentaren alltagsnah behandelt werden.
***
Am 28. Januar 2024, wurde im „Kontrafunk“-Internetradio in der Reihe „Audimax – das Kontrafunkkolleg“ der Hörfunkvortrag
Schule in Deutschland. Eine Verlustgeschichte
von Peter J. Brenner gesendet.
Die Sendung ist im Podcast hier gebührenfrei verfügbar.
Seit gut zwanzig Jahren haben die Pisa-Studien das deutsche Schulwesen nicht nur massiv kritisiert, sondern zugleich auch umfassend transformiert. Aber ihre Befunde zielen an den wahren Problemen des deutschen Schulwesens, besonders auch der beruflichen Schulen, weit vorbei. Tatsächlich ist es die Migrationspolitik, die seit Jahrzehnten die deutschen Schulen vor immer größere Belastungsproben stellt, die regional bereits zum Kollaps geführt haben. Wie es weitergeht, weiß niemand. Wahrscheinlich wird es auf eine immer stärkere Abschottung einzelner gesellschaftlicher und schulischer Milieus hinauslaufen.