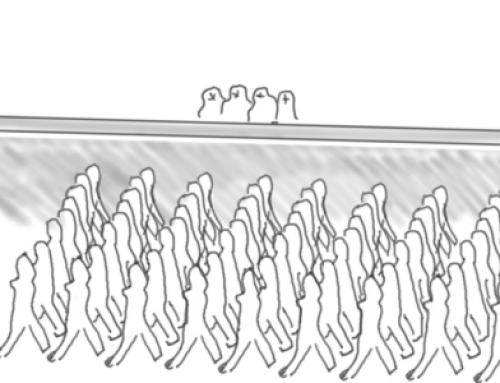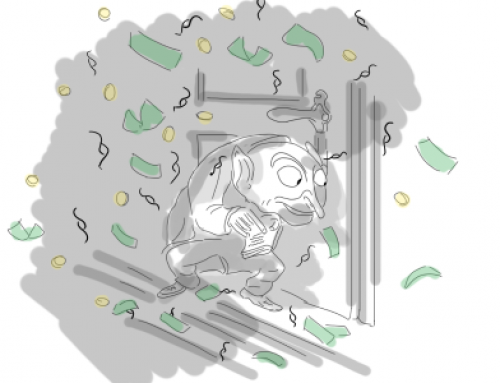Die klassische Literaturtradition
„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche,
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungs-Glück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.“
Es hat einmal eine Zeit gegeben, in der man nicht erklären musste, von wem diese Zeilen stammen, in welchem Werk sie erschienen sind und worauf sie sich beziehen. Das wusste jeder Volksschüler in Deutschland. Heute ist das anders. Die meisten der wenigen, die sich noch dafür interessieren, werden eine Suchmaschine bemühen müssen, und aufgeweckte Oberstufenschüler vermuten hinter der Hoffnung auf die wärmeren Tage des Frühlings gewiss ein klimaleugnerisches Manifest.
Das war nicht immer so. Diese Zeilen waren einmal fest im kulturellen Gedächtnis der Deutschen verankert, denn Werke des literarischen Kanons gehörten bis in die 1970er Jahre zum geistigen Horizont eines jeden deutschen Schülers. Literatur war ein Medium nicht nur nationaler, sondern auch bürgerlicher Selbstvergewisserung; nicht unnützer Zierrat und Gedächtnisballast, sondern der wichtigste Bestandteil jener kulturellen Bindekräfte, welche eine Gesellschaft zusammenhalten. Die Wertschätzung des klassischen kulturellen Erbes war auch die letzte Gemeinsamkeit zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Die Pflege des klassischen, wenn auch notgedrungen „bürgerlichen“ Erbes gehörte zum Leitprogramm der DDR-Kulturpolitik, auch wenn sie, je nach politischer Großwetterlage, mal in den Vordergrund geschoben, mal in den Hintergrund gerückt wurde.
Literatur diente also dazu, wie man heute so sagt, den „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ zu stärken. Das ist vorbei, und es sieht nicht so aus, als gäbe es allzu viele Menschen in Deutschland, die das als Verlust empfinden.
In den 1970er Jahren wurde in Westdeutschland dieser Form der kulturellen Identitätsstiftung ein Ende bereitet. Ganz grundlos war das nicht. Denn in der Schule mit literarischen Werken konfrontiert zu werden, kann recht qualvoll sein. Friedrich Schillers „Lied von der Glocke“ wurde zum Schreckgespenst ganzer Volksschüler-Generationen, welche die 425 Verse des Gedichtes bis in die 1960er Jahre hinein auswendig lernen mussten und sie ihr Leben lang hersagen konnten.
Diese Art von Literatur als Nukleus nationaler Identitätsstiftung war in den westdeutschen 1970er Jahren nicht mehr gefragt. Jetzt ging es vielmehr darum, Literatur in den Dienst zu nehmen für die Spaltung der Gesellschaft, als Instrument der Gesellschaftskritik und des Klassenkampfes. Das war eine ziemlich fruchtlose Angelegenheit, die dem gesellschaftlichen Prestige der Literatur nicht gut bekommen ist.
Der Bundeskanzler und die „Macht der Rede“
Aber auch heute wird das Buch noch zweimal jährlich zum Gegenstand medialer Aufmerksamkeit: anlässlich der beiden Buchmessen, in Leipzig im Frühjahr und in Frankfurt im Herbst. Auch in diesem Frühjahr traf sich die Buchwelt in den Leipziger Messehallen zum Rendezvous, und wo die Medien sind, ist die Politprominenz nicht fern.
Leipzig war in der Mitte des 18. Jahrhunderts einmal das Zentrum der deutschen Aufklärung und des deutschen Kulturlebens. Hier wurde Bachs „Matthäuspassion“ komponiert, der aus Preußen nach Sachsen geflohene Johann Christoph Gottsched vermittelte als führender Vertreter der deutschen Frühaufklärung die neuen Ideen aus Frankreich, die Universität genoss hohes Ansehen, ebenso wie die Theaterlandschaft. Die nächsten Phasen der Literaturentwicklung waren schon mit Christian Fürchtegott Gellert und mit dem Studenten Johann Wolfgang Goethe vertreten. Und schließlich war Leipzig der „Centralplatz“ des deutschen Buchhandels. Wichtige Verlage waren hier angesiedelt, und hier etablierte sich seit dem Ende des 16. Jahrhunderts die Buchmesse, die auch das „Dritte Reich“ und die DDR unter je eigenen Vorzeichen überstanden hat.
Im intellektuellen Milieu des 18. Jahrhunderts war man sehr weit davon entfernt, den Schulterschluss mit der Staatsmacht zu suchen. Die Vorstellung, der sächsische Kurfürst Friedrich August II. habe die Eröffnungsrede gehalten, hat etwas Komisches. Aber die Zeiten haben sich geändert. Dass man das Festpublikum einer Buchmesse-Eröffnung dazu bringen könne, nach der Rede des Bundeskanzlers auf Kommando geschlossen ein vorbereitetes Schild mit der Aufschrift „Demokratie wählen“ hochzuhalten, mit einer entrückt lächelnden Kulturstaatsministerin, einem Oberbürgermeister und einem Ministerpräsidenten in der ersten Reihe, hätte vor wenigen Jahren noch die Vorstellungskraft des phantasievollsten deutschen Schriftstellers überfordert. Jetzt ist es Wirklichkeit. Auch die restlichen 280 000 Besucher der Buchmesse wurden von der Messeleitung aufgefordert, sich in gleicher Weise selbst zum Narren zu machen.
Gemeint war es anders. Man wollte ein „starkes Zeichen“ setzen für die Demokratie und hatte den Bundeskanzler zur Eröffnungsrede eingeladen. Ausgerechnet er sprach nun über die „Macht der Rede“. Er nutzte die Gelegenheit, Klage zu führen über die, „die uns spalten wollen“. Die Aktivisten, die seine Rede massiv gestört haben, wird er nicht gemeint haben – die waren nicht rechts, sondern wünschten sich nur die Auslöschung des Staates Israels. Als Gegenmittel gegen die Spaltung empfahl der Bundeskanzler das, was zu empfehlen sich bei einer Buchmesse anbietet: Bücher lesen. Nun kommt es aber darauf an, welche Bücher jemand liest.
Man ist auf der sicheren Seite, wenn man preisgekrönte Bücher liest. Denn zum Buchmarkt gehören die Literaturpreise. Deren Zahl ist allein im deutschsprachigen Raum unüberschaubar geworden. Zurzeit dürften es 419 sein; und einer davon, der „Preis der Leipziger Buchmesse“ wurde auch in diesem Frühjahr mit viel medialem Pomp verliehen. Die Preisträgerin wurde Barbi Marković mit ihrem Büchlein „Minihorror“. Diese Wahl war nicht vorhersehbar, vorhersehbar war allerdings die Begründung der Jury, und was die Jury über die Figuren dieses Büchleins gesagt hat, gilt wohl auch für die meisten Preisträger des deutschen Literaturbetriebs: „Die beiden sind nicht von hier, bemühen sich dazuzugehören und alles richtig zu machen.“ Worum es geht, erläutert die Jury kurz und bündig: „hinten die Kriegsverbrechen, vorne der Klimawandel, dazwischen die Banalität unseres tagtäglichen Lebens“. Sicher werden auch diese 190 flockig mit Buchstaben übersäten Seiten ihre Käufer und Leser finden.
… aber „dem Buch“ geht es gut
Bei den Buchmessen werden die Bücher vorgestellt und mit Preisen überhäuft, die ihren Lesern Vergnügen bereiten, die sie glücklich machen, die ihnen die Zeit vertreiben, die zur Sinnfindung beitragen und zur Steigerung der Empathiefähigkeit, zur Lebensbewältigung und zur Persönlichkeitsentfaltung. Das wird gern gelesen. Der deutsche Buchmarkt ist ein nahrhafter Boden für gut lesbare Gefälligkeitsbücher, die am Ende dann den „Deutschen Buchpreis“ erhalten. Sie verschrecken ihre Leser allenfalls dadurch, dass sie Themen aus dem „Dritten Reich“ wählen, die besonders kühnen sogar solche, die mit Flucht, Vertreibung und Bombenkrieg zu tun haben.
Solche Bücher sorgen dafür, dass es „dem Buch“ in Deutschland auf paradoxe Weise gut geht, während es der Literatur immer schlechter geht. Der deutsche Buchhandel erzielt ein Drittel seines Umsatzes mit der „Warengruppe Belletristik“ und hinzu kommen noch 18 Prozent in der Sparte „Kinder- und Jugendliteratur“. Der Buchmarkt erzielte 2022 einen Umsatz von 9,5, Mrd. Euro, ein leichtes Minus gegenüber dem Vorjahr nach einem mehrjährigen leichten Anstieg. Gut 71 500 deutschsprachige Neuerscheinungen werden aktuell bei den beiden Buchmessen vorgestellt, 2022 haben sich 26 Millionen Menschen als Buchkäufer identifiziert, das sind 39 Prozent der deutschen Wohnbevölkerung ab 10 Jahren.
Angeblich werden diese Bücher auch gelesen. Jedenfalls behaupteten 2023 8,08 Millionen Personen in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren, dass sie täglich „ein Buch zur Hand zu nehmen“. Ob das stimmt, weiß man nicht, und was es heißt, „ein Buch zur Hand nehmen“, weiß man auch nicht. Aber immerhin bekunden solche Erhebungen, dass man sich nach wie vor gerne mit der Behauptung schmückt, man lese Bücher oder nähme sie zumindest in die Hand.
Wenn man ein Buch „zur Hand“ nehmen will, könnte man in eine der 8100 öffentlichen Bibliotheken in staatlicher, kommunaler, kirchlicher, gemeinnütziger oder privater Trägerschaft gehen, welche die Bevölkerung praktisch kostenlos mit Büchern aller Art versorgen. Da könnte es aber Probleme geben. Denn Bibliotheken sind „‚‚offen für alle Bürger, aber nicht offen für alle Inhalte!‘ Unser Medienbestand sollte die Bedarfe einer ‚Offenen Gesellschaft‘ bedienen, und nicht den Markt einer rechten Gesinnung“, heißt es in einem Fachblatt für das Bibliothekswesen, das sich offensichtlich auch als Zentralorgan für gute Gesinnung versteht. Mit dieser Auffassung befindet sich der Autor in bester Gesellschaft.
Gefälligkeitsliteratur im Zeichen des Regenbogens
Denn es gibt eben auch die Bücher, die man nicht mehr haben will, die keine Preise bekommen, die man aus den Bibliotheken verbannen will und die man öffentlich ächtet. Dafür gibt es neue und interessante Instrumente. Ein gewisses Renommee haben sich „Triggerwarnungen“ erworben. Sie findet man auf der Schmutztitelrückseite – dort, wo früher die Widmungen standen – ganz ernstgemeint in den Büchern einst angesehener Verlage: „Liebe Leser:innen, dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Dazu findet ihr eine Triggerwarnung auf S. 281“ kann man dann lesen. Solche Warnungen können sich auf bestimmte Inhalte beziehen, wie sie in der Weltliteratur nun einmal zu finden sind, oder auch auf einzelne Wörter, die „empfindsame Leser“ als „verstörend“ empfinden könnten. Selbstverständlich geworden ist auch der Hinweis, dass dieses Buch „klimaneutral produziert“ sei, weil der Verlag sich nun einmal zur Einhaltung der Klimaziele verpflichtet habe. Bevor der Leser also auch nur die erste Zeile des Buches gelesen hat, weiß er, dass er die richtige Wahl getroffen hat.
Aber eigentlich ist das nur die zweitbeste Lösung. Statt die Leser vor falschen Büchern und Textstellen zu warnen, ist es besser, wenn man ihre Entstehung gleich verhindert. Dafür gibt es den neuen Berufsstand des „Sensitivity Reader“ für Personen mit abgeschlossenem Genderstudium. In der Zürcher „Weltwoche“ hat im März 2023 einmal ein Autor aus der Schule geplaudert: Sein Afrika-Reisebericht wurde von einer aufmerksamen Sensitivity-Readerin rigoros sprachlich auf Linie gebracht. Verboten sind, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt, die Wörter „gross, klein, stämmig, wuchtig, kräftig, schlank, füllig, dick, hellhäutig, mit ebenmässigen Gesichtszügen, den Kopf glattrasiert“. Über sich selbst darf der Autor übrigens sagen, dass er „schmächtig und unsportlich“ sei. Reiseerlebnisse, die als „muslimfeindlich“ gedeutet werden könnten, werden gestrichen, die Erwähnung der Tatsache, dass die Deutschen eine Bahnlinie gebaut haben, ist „kolonialismusfreundlich“, aus „Stamm“ muss ein „tribe“ werden, aus dem „Häuptling“ ein „chief“ und aus „Schwarzafrika“ wird „Subsahara-Afrika“. Ständig wird der Autor im Sensitivity-Gutachten ermahnt, er möge es doch unterlassen, seine rassistischen Vorurteile dem Leser nahebringen.
Unter den Händen der Sensitivity-Readerin schrumpft der Wortschatz auf Drittklässlerniveau, und am Ende kommt ein Buch in „leichter Sprache“ heraus, ein sprachlicher Standard, den das gerade in Leipzig preisgekrönte Buch von vornherein, ohne korrigierende Eingriffe schon hatte.
So war das eigentlich nicht gedacht mit der Literatur. Gerade erinnert man sich an Franz Kafka, dessen hundertsten Todestags demnächst zu gedenken ist. Zum Thema Gefälligkeitsliteratur hat er gesagt, was zu sagen ist: „Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch?“ Durchdringen wird Kafka damit nicht. Wie man hört wurde auch er inzwischen postum in den Malstrom des Kulturbetriebs hineingezogen. Es heißt, dass sein Leben vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen verfilmt und versendet worden sein soll.
Finger weg – „Lob des Analphabetentums“
Das Lesen von Literatur ist nun einmal nicht jedermanns Sache, und eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass literarische Werke weitgehend aus dem Schulunterricht verbannt wurden. Es würde einer modernen Gesellschaft nicht gut bekommen, wenn sie nur aus leidenschaftlichen Lesern anspruchsvoller Literatur bestünde. Vor Jahrzehnten schon hat Hans Magnus Enzensberger in seinem „Lob des Analphabetentums“ anlässlich der Verleihung ausgerechnet des Heinrich-Böll-Preises 1985 die Frage gestellt, ob denn nicht die geschriebenen Wörter überhaupt entbehrlich seien. Zur Förderung der Lebensführungskompetenz taugen sie jedenfalls nicht. Im Gegenteil: Der „sekundäre Analphabet“ leidet nicht unter seinem Bildungsmangel, weil er nicht weiß, dass er daran leidet; er ist mobil, anpassungs- und durchsetzungsfähig. Da kann Literatur nur stören.
Die Elite dieser neuen Analphabetenschicht findet sich heute im Deutschen Bundestag und auf der Regierungsbank. In seiner Leipziger Rede versicherte der Bundeskanzler, er habe früher viel gelesen. Das kann man glauben oder auch nicht. Die jüngere Generation der Minister und Abgeordneten hält solche Beteuerungen gleich für überflüssig. Man würde sie ohnehin nicht glauben, und einen Prestigezugewinn könnten sie sich in ihrer Klientele damit nicht versprechen. Deutsche Politik wird heute von Menschen betrieben, die sich aus den kulturellen Traditionen des Abendlandes verabschiedet haben, denen alle Formen kultivierten Lebens fremd geworden sind. Aber andererseits gilt auch: Wer keine Beziehung zur Literatur hat, soll die Finger von ihr lassen. Denn auch der Literatur ist die Nähe zu diesem Milieu schädlich, und wenn auch noch so viele Preise, Ehrungen, Lobreden und Demokratiefördergelder über sie ausgeschüttet werden. Enzensberger jedenfalls hat im Bedeutungsverlust der Literatur eine neue Chance gesehen: „Sie ist vogelfrei, das ist immerhin auch eine Form von Freiheit.“
***
Am Ostersonntag, dem 31. März 2024, wurde im „Kontrafunk“-Internetradio in der Reihe „Audimax – das Kontrafunkkolleg“ der Hörfunkvortrag
Orden, Titel, Ehrenzeichen: Die deutsche Gesellschaft
und ihre Rangordnungen
von Peter J. Brenner gesendet.
Die Sendung ist im Podcast hier gebührenfrei verfügbar.
Jede Gesellschaft kennt Rangordnungen und soziale Unterschiede, und jede Gesellschaft macht diese Unterschiede durch symbolische Formen kenntlich. Das staatliche Orden- und Auszeichnungswesen musste im Deutschland des 20. Jahrhunderts dreimal mit einigem Aufwand neu sortiert werden. Die modernen Gesellschaften der Gegenwart gehen sorgloser mit Formfragen um. Dadurch wird der alltägliche Umgang miteinander nur scheinbar unkomplizierter, denn reale Machtverhältnisse verschwinden dadurch nicht.