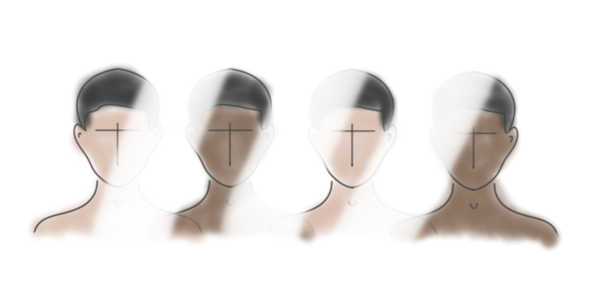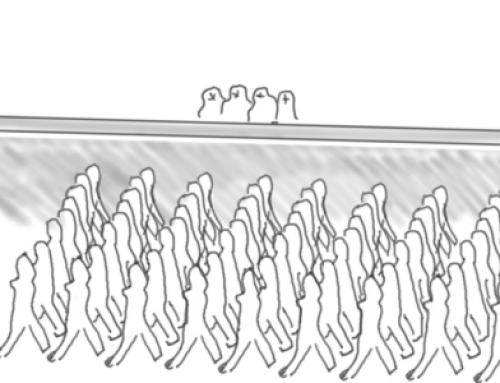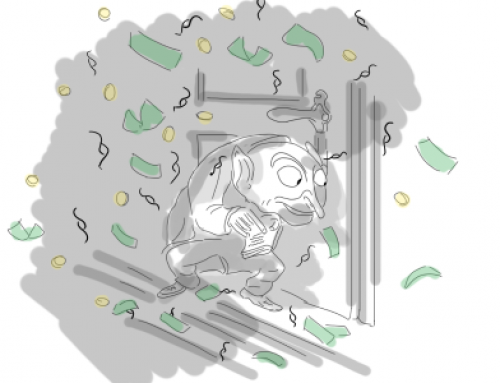Weiterführende Erörterungen zum Thema finden sich in der „Lesepult“-Buchkritik: Achim Bühl, Rassismus. Zur Anatomie eines Machtverhältnisses
Rassismus als Medienevent
„Rassismus“ ist ein ernstes Thema. Niemand kann bestreiten, dass es Rassismus gibt, auch in Deutschland; und unstrittig ist es auch, dass eine zivilisierte Gesellschaft – das ist etwas ganz anderes als eine „Zivilgesellschaft“ – dem Rassismus entgegentreten muss, wo immer er sich zeigt. Insbesondere der Rassismus in der Gestalt des Antisemitismus, dessen Wurzeln in der europäischen Gesellschaft Jahrtausende zurückreichen, ist eine stets virulente Gefahr, die in den letzten fünf Jahren noch einmal zugenommen hat.
Aber nicht jedes Gerede über den Rassismus ist auch ein Beitrag zum Kampf gegen den Rassismus. Wer permanent übertreibt, die gesellschaftliche Wirklichkeit in den schwärzesten Farben malt, die sich mit der Alltagserfahrung nicht mehr in Übereinstimmung bringen lassen, der nährt den Überdruss. Höchst zweifelhaft ist jedenfalls, ob die Welle der antirassistischen Empörung, welche die deutschen Medien, die Politik und die Zivilgesellschaft nach dem Tod des Amerikaners George Floyd erfasst hat, der Sache dient, um die es geht.
Es unterliegt überhaupt keinem Zweifel, dass ein wegen eines Bagatelldelikts Verdächtiger bei einem Polizeieinsatzes nicht zu Tode kommen darf, auch wenn seine Vorstrafenliste noch so lang ist. Aber ob dieser Todesfall etwas mit „Rassismus“ zu tun hat oder mit einer eskalierenden Situation oder mit der mangelhaften Rekrutierung und Ausbildung von Polizeibeamten in amerikanischen Großstädten oder mit allem zusammen oder mit nichts von allem – das weiß man nicht oder, genauer: Man weiß es umso besser, je weiter man vom Tatort entfernt ist. Denn auch in den höchstrangigen deutschen Qualitätsmedien gibt es keinerlei Zweifel daran, dass George Floyd Opfer rassistischer Polizeigewalt geworden ist. So konnte dieser Vorfall in Deutschland zu einem Auslöser exzessiver medialer Aufmerksamkeitsbewirtschaftung werden.
Fernsehrassismus
Der Talkshowmasterin Sandra Maischberger unterlief in der 23. Kalenderwoche das Missgeschick, zu ihrer Sendung über die aktuelle Protest-Situation in den USA nur weiße Gäste eingeladen zu haben. Nach den vorgängigen Twitter-Protesten wurde dann zügig die afroamerikanische, also schwarze Germanistik-Professorin Priscilla Layne aus North Carolina per Video zugeschaltet.
Etwas klüger fädelte es vier Tage später Anne Will ein. Ihr war es gelungen, zwei Personen, Frauen sogar, einzuladen, die als BPOC – Black and People of Color – durchgehen konnten und über eigene Rassismuserfahrungen in Deutschland sprechen durften. Die eine, Alice Hasters, eine 31-jährige Journalistin, hat sich in ihrem Buch „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen“ und in zahllosen Fernseh- und Presseinterviews über ihre alltagsrassistische Diskriminierung beklagt, die aber jedenfalls nicht zu einem Ausschluss aus der Medienöffentlichkeit geführt hat. Die andere, Samira El Ouassil, Tochter eines Marokkaners und einer Deutsch-Amerikanerin, ist nicht ganz so schwarz, hat aber den schöneren Namen. Parallel zu dieser Anne-Will-Sendung lud im öffentlich rechtlichen Schwesterkanal ZDF die Fernsehmoderatorin Marietta Slomka den deutschen Comedian Marius Jung unverkennbar seiner schwarzen Hautfarbe wegen ein, um ihn über Rassismus in der deutschen Gesellschaft befragen. Maybrit Illner schließlich war mit ihrer Rassismus-Sendung vom 25. Juni 2020 etwas spät dran. Eine richtige Person of Color war nicht mehr übrig, sodass sie sich mit der Kabarettistin Idil Baydar als Expertin – für was? – begnügen musste, die aber immerhin, der Name deutet es an, türkische Wurzeln hat, ebenso wie der gleichfalls anwesende Grünen-Politiker Cem Özdemir, der bereits bei Anne Will dabei gewesen ist.
Wie muss man sich das vorstellen? Ob die Talkshowredaktionen für ihr Casting Exceltabellen führen, in denen nicht nur die Parteizugehörigkeit und die Fernsehtauglichkeit potenzieller Gäste aufgeführt werden, sondern auch die Hautfarbe? Vielleicht auch noch das Geschlecht – genauer: die „sexuelle Identität“ –, die Religionszugehörigkeit und die Kopfbekleidung? So hat es damals auch angefangen. Götz Aly und Karl Heinz Roth haben es in ihrem Buch über die „restlose Erfassung“ beschrieben.
In diesen Talkshow-Runden sind Privilegierte unter sich, die ihre Luxusprobleme hin und her wenden. In den Medien wie in der Politik gibt es eine Rangordnung der Diskriminierungsopfer. People of Color, möglichst weiblich und mit höherem Bildungsabschluss – am besten irgendwas mit Medien, dann ist man unter sich – kommen immer gut an im Fernsehen. Aber die im Dunkeln sieht man nicht, weil sie im Dunkeln bleiben. Oder kann sich jemand daran erinnern, dass in irgendeiner der großen Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens einmal eine Sendung über die Diskriminierung von Behinderten in Deutschland gezeigt wurde? Über rassistische Diskriminierungserfahrungen im deutschen Alltag, auf der Straße oder in der Schule, hätte wohl auch ein kippatragender Berliner Jude etwas zu sagen gehabt. Aber dann wären vielleicht unangenehme Befunde zur Sprache gekommen. Oder was ist mit den Lebensverhältnissen der im Zuge der Flüchtlingskrise zugewanderten Frauen? Einem Fernsehteam von Spiegel.tv gebührt das Verdienst, in einer gebührenfreien Reportage einen achtminütigen Blick in diese Lebenswelt ermöglicht zu haben. Die hier gezeigten Frauen hätte man sich einmal in einer Talkshow gewünscht. Dazu bräuchte man aber die Genehmigung ihres Ehemannes, der bei beiden Frauen der gleiche ist, und einen Dolmetscher. Einen Corona-Mundschutz aber bräuchte man nicht.
Stuttgart: Ein „Muster mit Zukunft“?
Bei Maischberger durfte die schwarze Germanistik-Professorin Priscilla Layne die Ansicht verbreiten, die Plünderungen im Zuge der amerikanischen George-Floyd-Demonstrationen seien eine legitime Form des Protests der schwarzen Bevölkerung gegen ihre jahrhundertelange Unterdrückung, da andere Protestformen wirkungslos geblieben seien. Die ersichtlich überforderte öffentlich-rechtliche Gastgeberin hatte dagegen nichts einzuwenden: „So lange dabei niemand zu Tode kommt, ist das jedenfalls ein Punkt“. Der „Punkt“ war dann wiederum 17 Tage später erreicht. Am späten Abend des 20. Juni 2020 gab es in der Stuttgarter Innenstadt schwere Ausschreitungen von rund 500 Personen, bei denen nach Polizei- und Medienangaben 34 Polizisten verletzt, 40 Geschäfte verwüstet und neun geplündert wurden.
Zu Tode kam niemand, insoweit war also alles in Ordnung. Da diesmal keine Journalisten, sondern nur Polizisten verprügelt wurden, hat man die gewalttätige Dimension dieser Ausschreitungen in den Medien ziemlich entspannt behandelt.
„Nach Stuttgart“ wurde gerätselt, was da eigentlich passiert war. In Windeseile wurden Sprachregelungen und ein Framing entworfen, um die Ereignisse in die bundesdeutsche Diskurslandschaft einzupassen: Sie hätten keine politische Motivation gehabt und mit dem Islam hätten sie auch nichts zu tun, sondern hätten ihre Ursprünge in der – dann allerdings etwas sonderbaren – Stuttgarter „Partyszene“.
Rätselhaft ist eigentlich nichts daran. Der Kriminologe Werner Sohn hat vor einigen Jahren bereits auf die Entwicklungen hingewiesen, die sich in England abzeichneten und die ein „Muster mit Zukunft“ auch für Deutschland zu werden versprechen. Die „London Riots“ von 2011 und 2014/15 waren, wie zuvor die bürgerkriegsähnlichen Zustände in den Banlieues in Paris, nur der Auftakt für eine Entwicklung, die sich verdichtet. Sohn fasste die Befunde zusammen: Multiethnische Gesellschaften, denen vor allem in verdichteten urbanen Räumen „hohe Anpassungsleistungen aufgezwungen werden, leiden unter einer Auszehrung des sozialen Zusammenhalts“.
Krawalle dieser Art, mit oder ohne migrantische Beteiligung, gibt es auch in Deutschland schon seit langem. Neu an Stuttgart war nur, dass in diesem Fall nicht die Randbezirke betroffen waren, nicht die Banlieues, die es auch in Deutschland gibt, die No-Go-Areas, die Ghettos, die Siedlungen der Abgehängten oder die einschlägig angesagten Kieze. Betroffen war diesmal die Stuttgarter Innenstadt, die Hauptstadt des schwäbischen Musterländles, die einen grünen Oberbürgermeister und einen grünen Ministerpräsidenten beherbergt, der den Krawallen von seinem Amtssitz aus zuschauen konnte. Die Grünen erreichten bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr im Wahlbezirk Stuttgart-Mitte über 30% der Stimmen, genau doppelt so viel wie die CDU und dreimal so viel wie die SPD. Es muss schmerzhaft sein, wenn dieses politisch-kulturelle Milieu mit den Folgen seiner eigenen Politik hautnah konfrontiert wird.
„Es gibt kein Grundrecht auf innere Sicherheit“
Der jetzige Bundesaußenminister hat, als er noch – niemand weiß genau wieso – Bundesjustizminister war, im Dezember 2014 gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ eine erstaunliche Feststellung getroffen: „Es gibt kein Grundrecht auf innere Sicherheit“. Aber weit wirkungsvoller als Dummheiten dieser Größenordnung sind die kleinen medialen Finessen, mit denen tagaus tagein den Medienkonsumenten ein Bild der deutschen Gesellschaft eingeprägt wird, die beherrscht sei von strukturellem Rassismus und polizeilicher Willkür. Einer der größten Exzesse öffentlicher Gewalt seit fünfzig Jahren, die Ausschreitungen beim Hamburger G20-Gipfel, wurde auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – in einer im Juni 2020 ausgestrahlten Arte-Sendung von Sebastian Bellwinkel – wesentlich als Folge polizeilichen Fehlverhaltens, nämlich „mangelhafter Deeskalation“ beschrieben. Die Sendung war übrigens mit der Trigger-Warnung versehen, sie sei für „empfindsame Zuschauer“ nicht geeignet. Nach den Stuttgarter Exzessen kam die Redakteurin der „Süddeutschen Zeitung“ Constanze von Bullion in einem lesenswerten Kommentar zu einem ähnlichen Schluss: „Der Staat trägt dazu bei, dass Eingewanderte sich entfremden oder fremd bleiben“.
Wenn schließlich US-amerikanische Problemlagen inklusive ihrer politisch-moralischen Symbolik in die deutsche Diskussion importiert werden, kann das nur schief gehen. „Black lives matter“ ist ein Schlagwort, das in den USA seinen Sinn haben mag. An den Problemen der deutschen Gesellschaft zielt es weit vorbei. Und wenn nicht nur Fußball‑ und Basketballspieler, sondern auch deutsche Polizisten in Köln in einer obszönen parareligiösen Geste vor jugendlichen Demonstranten niederknien, um sie um Verzeihung zu bitten – für was? –, dann ist es ein fatales Signal. Den Respekt vor der Polizei stärkt es sicher nicht, weder bei den deutschen noch bei den zugewanderten Jugendlichen, allenfalls bei den Medienschaffenden.
Auf dem Weg in eine misstrauische Gesellschaft
Auch wenn es paradox klingt: Beängstigender als die zunehmenden gewalttätigen Ausschreitungen auf Deutschlands Straßen sind die „Rassismus“-Diskussionen in den Fernsehtalkshows und den Qualitätsmedien, die mit den Demonstrationen der Zivilgesellschaft auch die Macht der Straße hinter sich wissen. Mit den Gewaltausbrüchen zu leben wird man auch in Deutschland lernen müssen, genau wie man es in Frankreich, in England, in Belgien, in den Niederlanden und in den USA gelernt hat. Der Gewalt kann man meistens aus dem Weg gehen, man kann sie einhegen und isolieren oder sie als unvermeidbare Folgekosten einer historisch beispiellosen Kette politischer Fehlentscheidungen einfach hinnehmen.
Viel bedrohlicher ist auf lange Sicht aber das, was sich im oberen Segment der Gesellschaft abspielt, in den Medien und bei den Kulturschaffenden, den – nach heutigen Maßstäben – Gebildeten und Einflussreichen. Die von ihnen geschürte Rassismus-Debatte sät Misstrauen. Eine Gesellschaft aber lebt von dem Vertrauen, das ihre Bürger einander wechselseitig ebenso entgegenbringen wie den ordnungsstiftenden Kräften des Staates. Dieses Vertrauen kann man nicht erkaufen und nicht ersetzen durch ständig übersteigerte Wohlfahrtsleistungen, die gerade in der Corona-Krise eine historisch neue Dimension erhalten haben. Man kann es auch nicht erzwingen, indem man „die ganze Härte des Gesetzes“ dort anwendet, wo etwas aus dem Ruder gelaufen ist.
Vertrauen muss erworben werden, und es muss auf gesicherten Fundamenten aufbauen können. Es speist sich aus kulturellen Vorleistungen, aus unbefragt geltenden tradierten Wertvorstellungen und aus Konventionen des Verhaltens, die von Kindheit an eingeübt werden. Die Rassismus-Diskussionen bringen diese kulturellen und sozialen Quellen der gesellschaftlichen Integration zum Versiegen. Sie stellen jede historische Kulturleistung, jede staatliche Einrichtung und am Ende das Alltagsverhalten eines jeden einzelnen unter rassistischen Generalverdacht . So entsteht eine Gesellschaft des Misstrauens: Wenn jeder Blick, jede Geste, jedes Wort von vornherein unter Rassismus-Verdacht steht, dann werden die grundlegenden Selbstverständlichkeiten des alltäglichen Zusammenlebens ausgehöhlt. Dann ist kein unbefangenes Miteinander mehr möglich.