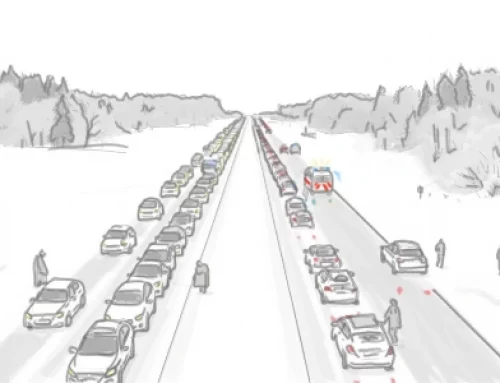Am Ende der Sprachspirale
Mitten in der Corona-Krise, am 24. Mai 2020, Deutschland zählte 8265 Tote, wies die führende Talkmeisterin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Anne Will, auf die eigentlich wichtigen Probleme des Landes hin. Sie sprach ihren Gast Reiner Holznagel, den Präsidenten des „Bundes der Steuerzahler“, als Präsidenten des „Bundes der Steuerzahler_innen” an. Gekrönt wurde der Coup dadurch, dass es der Showmeisterin auch gelang, den geschriebenen Unterstrich gendersprachlich korrekt, nämlich durch stimmlosen glottalen Plosiv – oder auch „Lautverschluss“ – auszusprechen. Das erfordert einigen häuslichen Übungsaufwand, aber die Mühe wurde durch hohe öffentliche Aufmerksamkeit belohnt. Da konnten die konkurrierenden öffentlich-rechtlichen Kollegen nicht zurückstehen. Der führende Anchorman des auch diesmal nur zweiten deutschen Fernsehens tat es ihr umgehend gleich.
Nicht ganz auf der Höhe der Zeit war hingegen die Moderatorenkollegin Marietta Slomka. Am 7. Juni 2020 erklärte sie in einem Interview mit dem bewundernswert geduldigen Kabarettisten Marius Jung über rassistische Sprache: „Wir sind beide Spracharbeiter, Sie als Kaberettist“ – so steht es tatsächlich auf der offiziellen Website des ZDF, wo offensichtlich noch mehr Spracharbeiter beschäftigt sind –, „ich als Journalistin“. Richtig wäre gewesen: Wir sind beide Spracharbeitende oder, noch besser, Spracharbeiter_innen.
Mit dem gesprochenen Gender Gap ist das Ende der Genderspirale erreicht. Nachdem Lexik, Orthographie, Grammatik und Pragmatik durchgegendert sind, wird jetzt auch die Phonetik, die Art und Weise, wie ein Wort ausgesprochen wird, heim ins Reich der politischen Korrektheit geholt. Wer vor „Bologna“ ein sprachwissenschaftliches Fach studiert hat, wird sich noch an den „Glottisschlag“ erinnern, den Kehlkopfverschluss, der einen „gepreßten Vokaleinsatz bewirkt.“ In Kröners „Lexikon der Sprachwissenschaft“ heißt es weiter dazu: „Außerlinguistisch findet sich der G. beim Husten, Räuspern und als Füllsel bei unsicheren Rednern.“ So hört sich das auch an. Werden die Journalistenschulen und Universitäten künftig Sprecherziehungskurse anbieten, wo man, wie einst in Loriots legendärer Jodelschule, Glottisschlagdiplome erwerben kann, bis am Ende aus den Deutschen ein Volk von Gicksern und Gacksern geworden ist?
Wer spricht Gender?
Der linguistische Talibanismus scheint nirgends so ausgeprägt zu sein wie in Deutschland. Den Deutschen am nächsten kommt noch die Diskussion in Frankreich. Hier wurde die „écriture inclusive“ von der kulturfundamentalistischen Ministerin Najat Vallaud-Belkacem forciert, die sich übrigens erklärtermaßen am „deutschen System“ orientierte. Das führte zu so charmanten Schreibweisen wie „chèr·e·s lecteu·rice·s“. Als 2017 das erste französische Schulbuch dieser Schreibweise folgte, wurde es den Franzosen zu bunt, denn sie haben immer noch einigen Respekt vor ihrer eigenen Sprache und Kulturtradition. Der damalige Premierminister Édouard Philippe untersagte seinen Behörden diesen Sprachgebrauch.
Es versteht sich von selbst, dass bei diesen Entwicklungen die Hochschulen vorneweg marschieren. Die deutschen Universitäten haben wohl durchgehend einschlägige Gendersprachregelungen für ihre Verwaltungen erlassen. Wie es allerdings im Studien- und Prüfungsbetrieb aussieht, ist undurchsichtig. Immer wieder hört man Gerüchte, dass Professoren – und vor allem Professorinnen – das akademische Machtgefälle missbrauchen und ihre studentischen Schutzbefohlenen unter Androhung von Sanktionen in Form schlechterer Noten zu einem gendergemäßen Sprachgebrauch zwingen. Genaues weiß man aber nicht. Universitäten und Professoren halten sich auf Anfrage bedeckt und murmeln etwas vor sich hin, dass man den Studenten entsprechende Hinweise gebe, keineswegs aber mit Sanktionen drohe. Das mag so sein oder auch nicht. Es ist jedenfalls eine erheiternde und keineswegs abwegige Zukunftsvision, dass bald nicht nur in schriftlichen akademischen Arbeiten zwangsmäßig gegendert wird, sondern dass auch bei mündlichen „Präsentationen“ und Prüfungen die Studenten vor sich hingicksen müssen
Juristisch ist das ein heißes Eisen. Wenn wirklich der Gendersprachgebrauch in die Notenbewertung einfließen sollte, müsste das in den Modulordnungen ausdrücklich als eine zu erwerbende „Kompetenz“ festgelegt werden – vielleicht als „Sprachinkompetenzkompetenz“. Davor scheut man noch zurück und lässt die Betroffenen im Unklaren über das, was gilt und was nicht gilt – ein weitaus effektiveres Instrument der Machtausübung. Selbst für die Lehrerausbildung zuständige Ministerien vermeiden inzwischen eine klare Aussage dazu, ob die nach ihrem eigenen „Amtlichen Regelwerk“ definitiv fehlerhafte Verwendung des „Gendersterns“ in der universitären und schulischen Prüfungspraxis als Fehler zu bewerten ist.
Auch deutsche Großstädte haben sich der Bewegung angeschlossen. In Hannover wurde Anfang 2019 dekretiert, dass im amtlichen Umgang mit den Bürgern „geschlechtsumfassende Formulierungen“ verwendet werden müssen. Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel folgte im Jahr darauf. Im Mai 2020 erklärte sie den „lieben Kieler*innen“ und „lieben Lesenden“ in einer 15-seitigen Broschüre, was von ihnen erwartet wird. In ihrer Argumentation und ihrem Sprachduktus ist die Broschüre auf dem gleichen Drittklässler-Niveau angesiedelt wie das famose „Framing-Manual“, mit dem sich die ARD im Jahr zuvor blamierte. Allerdings kostete die Kieler Sprachgerechtigkeitsaktion nur halb so viel: 50 000 Euro wurden an „Fairlanguage – GFGK Gesellschaft für gerechte Kommunikation mbH“ als externe Beratungsagentur überwiesen. Herausgekommen ist das: „Wenn Menschen in Kiel adressiert oder über sie gesprochen wird, verwenden wir grundsätzlich das Gendersternchen, um die Vielfalt der Menschen in Kiel sichtbar zu machen.“ Das hier fehlende Verb in Pluralform scheint im Preis nicht mehr enthalten gewesen zu sein. Ziemlich witzig ist übrigens die Vorstellung, man könne eine gendergerechte „Sensibilisierung“ durch rüde bürokratische Vorschriften erreichen, denen die Sensibilität nicht gerade auf die Stirn geschrieben steht.
Auf dem freien Medienmarkt können sich nur einige milieuabhängige Klientelprodukte wie das ehemalige SED-Organ „Neues Deutschland“ oder die „tageszeitung“ mit ihrem jeweils überzeugungstreuen Kundenstamm eine solche aggressive Sprachpolitik leisten. Die Redaktion des Relotius-Magazins „Der Spiegel“ würde das sicher gerne auch, sieht sich aber vermutlich angesichts schrumpfender Leserzahlen dem Einspruch der kaufmännischen Abteilung ausgesetzt. So wurde eine bemerkenswerte Zwischenlösung gefunden: In einem Anfang 2020 verabschiedeten Sprachleitfaden – auch er in einer Sprache verfasst, als sei er für Schülerzeitungsredakteure gedacht – werden die Damen und Herren Redakteure gebeten, stärker auf geschlechtergerechte Sprache zu achten. Eine konsequente Umsetzung sei zwar nicht praktikabel, aber wenigstens hin und wieder und ab zu sollte in den Artikeln abwechselnd mit dem generischen Maskulinum die weibliche Form verwendet werden.
Oft und oft wurde, auch von sympathisierender Seite, gefragt, was sich denn an der Wirklichkeit ändere, wenn man eine „gendersensible Sprache“ verwendet. Hat sich „die Situation“ von Frauen oder „diversen Personen“ wirklich gebessert durch das Erzwingen einer gendergerechten Sprache? Die von manchen sicherlich, sofern sie die Möglichkeit hatten, im expandierenden Gendergewerbe Lohn und Brot zu finden. Ansonsten fehlt aber jeder Nachweis, dass Sprachregulierungen irgendetwas zur sozialen Besserstellung von Discounter-Kassiererinnen oder Gebäudereinigerinnen beigetragen hätten. Selbst beim ZDF, das eine so vorbildliche Rolle bei der Umsetzung des Gender Gaps spielt, gibt es ein Gender Pay Gap: Während er, nämlich der Moderator Claus Kleber, deutlich über 500 000 Euro im Jahr bekommen soll, erhält sie, Marietta Slomka, nur 280 000 Euro, also gut die Hälfte, für die gleiche Arbeit und die gleiche Leistung – wenn man es einmal so nennen will – in der gleichen Sendung. Das sind Schätzungen von Branchenkennern. Die genauen Zahlen werden vom Sender geheim gehalten, auch gegenüber den Beitragszahlern, die diese Gelder aufbringen müssen.
Was sagt die Wissenschaft?
Nun würde man sich gerne vorbehaltlos auf die Seite des gesellschaftlichen Fortschritts stellen und freudigen Herzens diesen Sprachgebrauch übernehmen. Aber ein paar gute Gründe möchte man vorher doch hören, bevor man sich zum Narren macht und einen Sprachfehler simuliert, den man nicht hat.
So richtig überzeugend sind die sprachpraktischen Ergebnisse der Gendertheorie bislang jedenfalls nicht. Gendergerecht kann der Plural von „Lehrer“ auf zehn verschiedene Weisen ausgedrückt werden: (1) Lehrer und Lehrerinnen, (2) Lehrkräfte, (3) Lehrende, (4) Lehrer/innen, (5) LehrerInnen, (6) Lehrer(innen), (7) Lehrer*innen, (8) Lehrer_innen, (9) Lehrkraft (m/w/d), (10) LehrX. Ausgeschlossen ist nur die eine, die grammatisch korrekte Form des generischen Maskulinums: „die Lehrer“. Eine Theorie, die eine derartige babylonische Sprachverwirrung anrichtet, statt Klarheit zu schaffen, bedarf wohl noch einiger Nachbesserungen.
Auch sprachwissenschaftlich stehen die Gendersprachpostulate auf schwankendem Grund. Das grammatische Geschlecht bezeichnet kein biologisches Geschlecht, daran können noch so viele Gleichstellungsgesetze und behördliche Richtlinien etwas ändern. Das grammatische Geschlecht stellt Kongruenzbeziehungen innerhalb des Satzes her und macht keine Aussage über die Wirklichkeit. Wer je Nordamerikanern Deutsch als Fremdsprache unterrichtete, hat noch die verzweifelte Frage seiner Studenten im Ohr, warum denn der Mond männlich und die Sonne weiblich sei, wo doch die Frankokanadier wissen, dass es genau umgekehrt ist, während weiter südlich in den USA Mond und Sonne weder das eine noch das andere, sondern sächlich – heute wohl divers – seien, was die Mühen des Fremdspracherwerbs übrigens erheblich erleichtert.
Offensichtlich hat die Gendersprachwissenschaft noch einen weiten Weg vor sich, bis sie wenigstens auf dem Niveau angekommen ist, auf dem vor hundert Jahren Roman Jakobson und die Prager Strukturalisten schon waren. Denn die und ihre Nachfolger haben mit der Markiertheitstheorie einen linguistischen Denkansatz entwickelt, welcher die fraglichen Phänomene um einiges besser erklärt als das ganze „Nicht-Mitgemeint-Sein“-Gerede.
Wer zaghafte Zweifel anmeldet an der wissenschaftlichen Fundiertheit gendersprachlicher Praktiken, wird mit dem Hinweis barsch zum Schweigen gebracht, es gäbe „genügend Studien“, die bewiesen hätten, dass beim generischen Maskulinum „Frauen nicht mitgemeint“ seien. Solche Studien gibt es nicht und es kann sie nicht geben. Denn festzustellen, was mit einer sprachlichen Äußerung „gemeint“ oder gar „mitgemeint“ ist, gehört zu den ältesten und bis heute ungelösten Problemen der Sprach‑ und Sozialwissenschaften. Das, was gemeint ist, hängt immer vom Kontext ab, vom „Sprachspiel“ des je aktuellen Verwendungszusammenhangs, wie Wittgenstein es genannt hat.
Die Sprachwissenschaft weiß das, die Genderlinguistik will es nicht wissen. Dieses Problem im Design einer empirischen Studie zu erfassen, ist schlechterdings unmöglich, ganz abgesehen davon, dass solche Untersuchungen repräsentativ für den gesamten deutschen Sprachraum sein müssten und, dem Sprachwandel folgend, alle drei Jahrzehnte wiederholt werden müssten. Das also gibt es nicht. Was es gibt, ist eine Handvoll von Mikrountersuchungen für den deutschen Sprachbereich, in denen man durch Assoziationstests herausfinden will, was sich Leute so denken, wenn sie mit dem „generischen Maskulinum“ und alternativ mit „gendersensibler Sprache“ konfrontiert werden. Selbst dann erbringen diese Untersuchungen die gewünschten Ergebnisse nur bei wohlwollender Deutung.
Zum Beispiel wurden im Jahre 2000 an der Universität Göttingen „150 studentische Versuchspersonen“ – fast immer werden in diesen Untersuchungen Studenten herangezogen – getestet mit dem durchschlagenden Ergebnis, „dass generisch maskuline Formen zu mehr Repräsentationen männlicher Personen führten als die sprachlichen Alternativen“. Das eigentliche Ergebnis ist ein anderes: der Einblick in die entrückte Vorstellungswelt von Wissenschaftlern, die glauben, mit der Untersuchung von ihresgleichen, nämlich „studentischen Versuchspersonen“, könnten sie irgendeine Aussage über die sprachliche Wirklichkeit der deutschen Bevölkerung machen.
Im Katechismus der deutschen Gendersprachbewegung, der Broschüre „Richtig gendern“ des einst angesehenen Dudenverlags, werden ersatzweise handgestrickte Assoziationstests empfohlen, die man selbst durchführen soll. Das ist sicher ein hübsches Gesellschaftsspiel für müßige Stunden – aber Wissenschaft ist das nicht.
Macht und Moral
In dem besagten Büchlein „Richtig gendern“ heißt es treuherzig: „Trauen Sie sich! Verwenden Sie die Sprache so, dass sie Ihre Absichten angemessen wiedergibt. Es ist Ihre Sprache!“ Wenn es nur so wäre. Einer der lautstärksten Kritiker des „generischen Maskulinums“, Anatol Stefanowitsch, kurioserweise ein Berliner Anglistikprofessor, hat die Sache beim Namen genannt: Grammatik sei eine „Frage der Moral“, postulierte er 2018 in seinem gleichnamigen Buch, und nicht, wie minder fortgeschrittene Geister glauben könnten, eine der Verständigung. Und wer heute „Moral“ sagt, meint „Macht“: Deutungsmacht, politische Macht, finanzielle Macht. Darum geht es in diesen Diskussionen.
Seine Sprache so zu benutzen, wie es richtig und den eigenen Absichten entsprechend ist, kann zumindest in akademischen und behördlichen Milieus zu einer Mutprobe werden, zur sozialen Ausgrenzung und neuerdings auch zu dienstrechtlichen Konsequenzen führen. In einer Demokratie sollte es jedem frei stehen, seine gesellschaftspolitischen Ansichten öffentlich zu äußern, sie nur im Familienkreis, am Stammtisch, in der Wahlkabine oder eben gar nicht kundzutun. Die Gendersprachpolitik erlaubt das nicht mehr. Sie zwingt ein Bekenntnis ab. Mit jedem Satz, den man schreibt und mit jedem Wort, das man ausspricht, muss man zu erkennen geben, ob man dafür ist oder dagegen. Am 22. Januar 1935 wurde der „deutsche Gruß“ allen Beamten durch eine Anordnung des Reichsinnenministeriums zur freudigen Pflicht gemacht und auch von allen anderen Volksgenossen als Loyalitätsbeweis erwartet. Das kommt den Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts sonderbar vertraut vor.
Was noch kommt und wo das alles hinführt, weiß man nicht. Mit Unterschriftenlisten und Meinungsumfragen, bei denen sich das uneinsichtige und umso belehrungsbedürftigere Volk immer noch mehrheitlich gegen den Gendersprachgebrauch ausspricht, kommt man der Sache nicht bei. Am besten wartet man einfach ab. Denn das ist nicht der erste Versuch, aus einer natürlichen Sprache mit Hilfe staatlicher Repression eine künstliche zu machen. Aber die politische Sprachgeschichte lehrt: Am Ende gewinnt immer die Sprache.