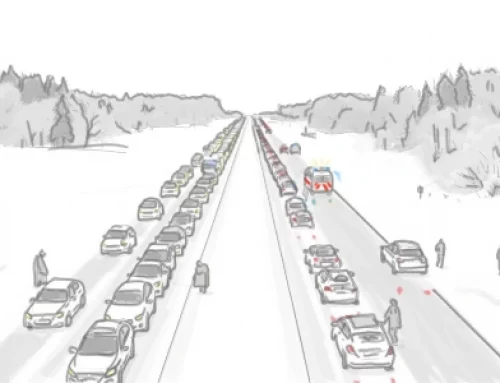Denkmalstürzer
Als im Februar 2001 die islamistisch-fundamentalistischen Talibane in Afghanistan Buddha-Statuen im Tal von Bamiyan zerstörten, war das eine Kulturtragödie welthistorischen Ausmaßes. Als im Sommer 2020 Aktivisten in England, den USA und auch im Hamburger Hafen anfingen, nach diesem Vorbild Denkmäler zu stürzen oder ihren Sturz zu fordern, war das ein Possenspiel. In den USA wurden Denkmäler von Südstaatengranden wie Robert E. Lee und Jefferson Davies, aber auch solche von Christoph Columbus beseitigt, mal mit, mal ohne die Zustimmung der zuständigen Stadtverwaltungen. In Großbritannien fielen die Statuen von Edward Colston – den ohne diesen Akt niemand kennen würde – und Winston Churchill den Bilderstürmern zum Opfer. In Deutschland wurde immerhin darüber diskutiert, ob man der Bismarck-Statue im Hamburger Hafen nicht den Kopf abschlagen müsse, um „ein Zeichen zu setzen“. Am Ende gab es vielleicht ein Dutzend solcher Vorgänge. Obwohl das alles eigentlich völlig bedeutungslos ist, hat es eine enorme Resonanz gefunden, nicht ganz zu Unrecht. Denn es handelt sich hier um aktivistische Aufgipfelungen von verstreuten subkulturellen Bewegungen, die neuerdings unter der Dachmarke „Cancel Culture“ eine gemeinsame mediale Heimat gefunden haben.
Mit „Cancel Culture“ ist die Zerstörung von – ausschließlich westlichen – Kulturgütern und Kulturtraditionen gemeint, die in irgendeiner Form unter den Verdacht gestellt werden können, irgendwann im Laufe der Geschichte eine diskriminierende, unterdrückende, verletzende oder sonstwie unerwünschte Auswirkung gehabt zu haben.
Das Programm ist schnörkellos: Geschichte soll umgeschrieben werden; missliebig gewordene Wörter sollen aus historischen Texten entfernt werden, der Kanon des Lehrstoffes an Schulen und Universitäten soll bereinigt, Raubkunst soll zurückgegeben, Opfer kolonialer Herrschaft sollen entschädigt, europäische Kulturgüter und Traditionen sollen durch andere, außereuropäische ersetzt werden, die man zwar nicht kennt, denen aber dennoch ein moralischer Bonus zugeschrieben wird, und als rassistisch oder sexistisch oder sonst irgendwas gebrandmarkte Professoren in Berlin, Hamburg, Frankfurt oder anderswo sollen am Lehren gehindert, am besten ganz entlassen werden. „Cancel Culture“ ist also, kurz gesagt, der Versuch, Geschichte rückgängig zu machen und neu zu schreiben..
Diese Cancel-Culture-Politik folgt der sicher nicht falschen Einsicht, dass über die Menschen herrscht, wer über ihre Sprache herrscht. Ihre größten Triumphe konnte sie in der behördlich erzwungenen Durchsetzung der Gendersprache und mit der Umbenennung von Süßwaren und Apotheken erzielen; auch den fast schon wieder vergessenen zweifelhaften Erfolg, dass die unter dem historischen Titel „Stadtluft macht frei“ geplante bayerische Landesausstellung 2020 kurzfristig in „Stadtluft befreit“ eilfertig und widerstandslos umbenannt wurde, kann sie an ihre Fahnen heften. Das ausgedehnteste Kampffeld ist die namenspolitische Umdeutung des öffentlichen Raums. Hier hat sich die Stadt München an die Spitze der Bewegung gesetzt: 2016 wurde beschlossen, alle 6000 Straßennamen daraufhin überprüfen zu lassen, ob sie in einem „chauvinistischen, extrem frauenfeindlichen, militaristischen, rassistischen oder antisemitischen, nationalsozialistischen Kontext“ stehen.
Der Streit um Wörter
Es ist keineswegs so, dass jeder dieser Einzelfälle abwegig gewesen wäre. Die Geschichte einer jeden Gesellschaft hat ihre lichten Momente und ihre dunklen Flecken, und die Einschätzung dessen, was hell und was dunkel ist, ändert sich im Laufe der Zeit. Es gibt hinreichend Wörter, die man nicht verwenden sollte und Namen, die als Straßenbenennungen nicht taugen. Eine neue Qualität hat diese Entwicklung indes in den letzten Jahren durch die Kampagnen erhalten, die unbestreitbare Problemfälle als Ankerpunkte für uferlose Bezichtigungsfeldzüge nutzen, die weit über den eigentlichen Anlass hinausgreifen.
In der Wissenschaft und vereinzelt auch in den Medien gibt es immer wieder Menschen, die mit bewundernswerter Geduld bemüht sind, sich sachlich und differenziert mit diesen Bewegungen auseinanderzusetzen. Sie zeigen, dass das generische Maskulinum keine „Frauen unsichtbar“ macht, dass das Wort „Mohr“ keine diskriminierende, sondern im Gegenteil eine anerkennende Bedeutung hat und dass sich eine „Iltisstraße“ auf eine Marderart bezieht und nicht als Ausdruck neokolonialistischer Begehrlichkeiten zu deuten ist. Vergebliche Mühe. Dummheit lässt sich nicht belehren und Fanatismus lässt sich nicht bekehren.
Denn die Cancel-Culture-Propheten entziehen sich systematisch jedem wissenschaftlichen und überhaupt jedem rationalen Diskurs. Der Kern ihrer Strategie ist die uferlose Entgrenzung von Begriffen. Die Cancel-Culture-Begriffe sind inhaltsleer, sinnlos, grenzenlos. Wer sich darauf einlässt, hat von vorneherein verloren. Denn er wird schnell zum Opfer von terminologischen Hütchenspielen, in denen die Bedeutung von Wörtern fingerfertig nach Belieben ausgetauscht werden kann. Das gilt speziell für den in jüngster Zeit allgegenwärtig gewordenen „Rassismus“-Begriff. Es gibt schlechterdings keine soziale Verhaltens‑ und keine kulturelle Ausdrucksform mehr, die nicht als „rassistisch“ denunziert werden könnte.
Die einst angesehene Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat dankenswerterweise ein Wörterbuch politisch erwünschter Begriffe vorgelegt und dabei auch das „Weißsein“ definiert: „Mit Weißsein ist die dominante und privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnisses Rassismus gemeint“. Das führt zu der sonderbaren Konsequenz, dass Barack Obama, den man früher fälschlicherweise einmal für den „ersten schwarzen Präsidenten der USA“ gehalten hat, ein „Weißer“ ist, weil er unzweifelhaft eine „dominante und privilegierte Position“ im ebenso unzweifelhaft rassistischen Machtsystem der USA innegehabt hat. Verkehrte Welt.
„Rassismus“ gegen Weiße hingegen kann es „strukturell“ nicht geben, keine „Kartoffeln“ und keine „Almans“ und keine „toxische weiße Männlichkeit“. Denn „Rassismus“ kann sich nur gegen „People of Color“ richten. Warum das so sein soll, weiß der Himmel. Aber wer über die öffentliche Diskurshegemonie verfügt, braucht keine Gründe, keine Argumente, keine Fakten mehr, sondern nur noch willige Vollstrecker in den Medien.
Wissenslücken ozeanischen Ausmaßes und fundamentale intellektuelle Defizite bilden die Grundlage für die freche Selbstsicherheit, mit der bodenlose Behauptungen sich im öffentlichen Diskurs als unangefochtene Wahrheiten durchsetzen können. Wer über Kolonialismus oder Sklaverei redet, sollte, nach alten Maßstäben des politischen und des akademischen Diskurses, grundlegende historische Kenntnisse haben. Die würden sich in der Cancel-Culture-Bewegung indes nur als störend erweisen, genauso störend wie die Forderung nach Belegen dafür, dass in Deutschland „Rassismus“, „strukturell“ oder nicht, grassiert.
Eigentlich kann es darauf nur eine Antwort geben: Mit solchen Leuten diskutiert man nicht. Man bekämpft sie auch nicht. Man ignoriert sie.
Die Spur des Geldes
Mit politischen Kategorien sind diese Bewegungen und ihr medialer Erfolg ohnehin nicht zu erklären. Denn irgendeine erkennbare und ernst zu nehmende politische Programmatik lassen sie nicht erkennen, eine linke, die auf die Verbesserung der Lebensbedingungen unterprivilegierter Bevölkerungsschichten zielte, schon gar nicht.
Wer wissen will, was die Bewegungen wirklich antreibt, sollte eine alte Regel der Mafiabekämpfung beherzigen und der Spur des Geldes folgen. Von einem Meinungsmarkt zu sprechen, ist mehr als eine Metapher. Es trifft den harten ökonomischen Kern der politischen Diskussion in der Zivilgesellschaft. Denn es geht hier nicht nur um Macht und Einfluss und Diskursherrschaft. Es geht um Geld. Die Protestbewegungen sind marktförmig organisiert und ihre ideologischen Dienstleistungen stehen in Konkurrenz zueinander. Ihre Slogans ähneln denen der Werbeagenturen und folgen der gleichen Logik des globalen Branding: „Black lives matter!“, „#meToo“, „Fridays for Future“ oder eben „Cancel Culture“ sind internationale Marken geworden, mit denen sich gute Geschäfte machen lassen. Nicht von ungefähr wurde für „Fridays for Future“ Markenschutz beantragt und ein Rechtsstreit über die Verwendung dieses Namens wurde vor dem Landgericht Wiesbaden auch schon geführt.
Auch die Cancel-Culture-Ökonomie muss sich auf diesem Markt der Protestökonomie positionieren. Der Fridays-for-Future-Boom hat vielen der älteren Bewegungen, dem Antifaschismus, dem Feminismus, dem Antirassismus fast zwei Jahre lang das Wasser der öffentlichen Aufmerksamkeit abgegraben. Wie ein Geschenk des Himmels müssen den dadurch ins Hintertreffen geratenen Bewegungen die durch einen Polizeiübergriff hervorgerufenen Rassenunruhen in den USA vorgekommen sein. Sie haben zwar mit Deutschland nicht das Geringste zu tun, aber in einer stets nach neuen Empörungsanlässen suchenden und global agierenden Medien- und Politiklandschaft konnten sie doch als Zündfunke dienen, mit dem sich verlorenes Terrain wiedergewinnen ließ.
Das Rätsel harrt noch einer Lösung, warum das funktioniert, woher also der Erfolg dieser offensichtlich politisch und intellektuell völlig substanzlosen Bewegungen kommt. Gewiss spielt hier die Eigendynamik des Medienbetriebs eine Rolle, dem die symbiotische – oder parasitäre? – Bindung an den Protestbetrieb immer wieder neuen Stoff für neue Aufregungen bietet. Aber dem eigentlichen Kern der Sache kommt man erst dann ziemlich nahe, wenn man die Cancel-Culture-Bewegung in erster Linie als Verteilungskampf in einer Akademikerschicht deutet, die niemand wirklich braucht.
Verteilungskämpfe in der Schattenwirtschaft
In einem Gastkommentar für die umstrittene Tageszeitung „taz“ haben Robert Habeck, der nicht weiter vorgestellt werden muss, und Aminata Touré, Vize-Präsidentin des Landtags Schleswig-Holstein und Sprecherin der Grünen-Fraktion für Antirassismus, die nächste Runde des Verteilungskampfes eröffnet: „In der Zivilgesellschaft ist eine dauerhafte Stärkung und Förderung von Organisationen und Initiativen, die sich gegen Rassismus einsetzen, dringend nötig. Das sollte über ein Demokratiefördergesetz verankert werden.“ Die beiden Grünen-Politiker betätigen sich hier als Lobbyisten einer subkulturellen Schattenwirtschaft, die kein Volksvermögen produziert, sondern es verzehrt.
Wenn die Indizien nicht täuschen, handelt es sich bei den Cancel-Culture- und den vielen anderen Polit‑ und Klimaaktivisten, die von dieser Schattenwirtschaft profitieren, überwiegend um Personen mit Immatrikulationshintergrund. Aktuell gibt es an deutschen Hochschulen ziemlich genau vier Millionen Studenten und 20 438 Studiengänge. Angesichts dieser Zahlen ist das alte Versprechen des sozialen Aufstiegs durch Bildung längst nicht mehr einlösbar. Denn der Aufstieg durch Bildung stößt dort an seine Grenzen, wo der generelle Akademikerbedarf des Arbeitsmarktes gesättigt ist und nur noch sehr selektiv hochqualifizierte akademische Berufe nachgefragt werden. Wer dagegen „irgendwas mit Medien“ machen möchte, hat auf dem Arbeitsmarkt schlechte Karten, findet aber umgekehrt ein umso größeres Studienangebot vor: 223 mal gibt es Studiengänge „Medienwissenschaft“, 236 mal „Journalistik“, 301 mal „Kommunikationswissenschaft“, 309 mal „Politik“, 378 mal „Kulturwissenschaft“, ganz zu schweigen von den aus den klassischen Universitätsdisziplinen wie Germanistik oder Geschichte hervorgegangenen Studiengängen.
Die Absolventen auch dieser Studiengänge wollen versorgt werden. Die NGOs, die nach dem Vorbild der Amadeu Antonio Stiftung von der Regierung hofiert und subventioniert werden, bieten ein gewisses, wenn auch meist prekäres Arbeitsplatzangebot. Erfolgreiche Influencer à la Rezo sind selten, und an ein Unterkommen in den klassischen Medien ist kaum noch zu denken, auch wenn die Bundesregierung gerade angekündigt hat, die Zeitungsverlage mit 220 Millionen Euro zu unterstützen Dazu muss man noch die 65 585 006,57 Euro hinzurechnen, welche die Bundesregierung im ersten Halbjahr 2020 für Zeitungsanzeigen ausgegeben hat, um Werbung für ihre Politik zu machen und nebenbei Arbeitsplätze für Journalisten und deren publizistisches Wohlverhalten zu sichern.
Dieser Markt, auf dem sich die Verteilungskämpfe der zivilgesellschaftlichen Akteure abspielen, ist schwer durchschaubar. Er besteht zum weitaus größten Teil aus Mitteln der öffentlichen Hand und vielleicht auch noch aus Spenden. Immerhin gibt es einige Eckdaten. Der Löwenanteil kommt vom Familienministerium der promovierten Politologin Franziska Giffey. Allein im Jahr 2019 stellte das Bundesfamilienministerium 115,5 Mio. Euro für menschenfreundliche Projekte zur Verfügung und die Ministerin versprach eine Verstetigung der Förderung zunächst bis 2023. Das Bundesinnenministerium fördert im Jahr 2020 weitere Projekte mit zweistelligen Millionensummen: 35 Mio. Euro gab es für die politische Bildungsarbeit sowie rund 13,9 Mio. Euro zur Förderung der politischen Bildung und Prävention, weitere 15 Mio. zur Erforschung des Rechtsextremismus, während das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 12 Mio. Euro erhält. Dazu kommen erhebliche Zuwächse durch andere Ministerien oder Einrichtungen der öffentlichen Hand, durch Länder und Kommunen, Parteien und ihre Parteistiftungen und durch private Stiftungen.
Bei diesen Fördersummen handelt es sich um eine Art Helikoptergeld für perspektivlose Medien‑ und Kulturwissenschaftler. Sie finanzieren eine Schattenwirtschaft, in der Privilegierte um den Erhalt und die Ausdehnung ihrer Privilegien kämpfen. So entstehen Mikroidentitäten, die sich durch ihre ethnische Herkunft, ihre sexuelle Orientierung oder durch sonst irgendetwas von anderen abgrenzen und aggressiv moralische, politische und monetäre Ansprüche gegenüber dem Rest der Gesellschaft erheben. In diesen Verteilungskämpfen hat der einen Vorteil, der auf der richtigen Seite steht, die schrillsten Aktionen inszeniert und die abwegigsten Forderungen stellt. Das ist zurzeit die Cancel-Culture-Bewegung.