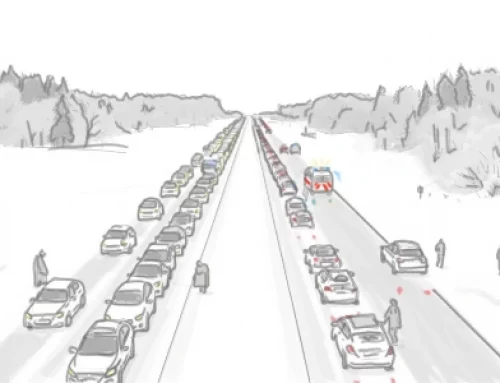Digitalisierung in Deutschland – eine Chronik des Scheiterns?
„Verschlafen“ habe die deutsche Schule die Digitalisierung, versagt habe sie, sich blamiert und lächerlich gemacht, und jetzt kämen auch noch die Lehrer mitten in der Corona-Krise und forderten, dass sie für ihren erzwungenen Online-Unterricht die erforderlichen Endgeräte von ihrem Dienstherrn zur Verfügung gestellt bekämen. Am lautesten klingt die Kritik aus den Redaktionsstuben jener Qualitätszeitungen, die 20 Jahre gebraucht haben, um halbwegs ansehnliche Webauftritte hinzubekommen, die als Geschäftsmodell immer noch nicht funktionieren.
Nun scheint sich aber alles zum Besseren zu wenden. Wenn die Corona-Krise auch sonst nur Unheil angerichtet hat, so scheint sie doch wenigstens das eine Gute zu haben, dass die deutschen Schulen, freiwillig oder nicht, einen mächtigen Digitalisierungsschub erfahren.
So richtig glauben mag man das nicht. Denn Corona hat neben vielem anderen auch gezeigt, wie desaströs unterentwickelt alle Infrastrukturen sind, die in der Hand der Politik liegen. Weder die von der Bundesregierung in Auftrag gegebene, von Telekom und SAP entwickelte, stark überteuerte und mäßig funktionierende, vollmundig als Allheilmittel angekündigte und kleinlaut wieder in die Kulissen zurückgeschobene „Corona-Warn-App“ noch die digitale Erfassung und Nachverfolgung von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter hat einen überzeugenden Eindruck hinterlassen – von der Organisation der Bevölkerungsdurchimpfung ganz zu schweigen.
Die Vorstellung, man könne mal schnell den rund 380 Gesundheitsämtern eine Software zur Nachverfolgung von Infektionsketten zur Verfügung stellen, ist sang- und klanglos gescheitert, weil sie von Anfang an verfehlt war. Denn viele Gesundheitsämter weigern sich nicht aus „Rückständigkeit“, sondern aus gutem Grund, eine in Deutschland für die Seuchenbekämpfung in Nigeria entwickelte und mit einem neuen Covid-19-Modul versehene Software einzusetzen. Denn so etwas bringt zunächst mehr Probleme als es löst. Wer nicht gerade Politiker oder Journalist ist, weiß das und kann gut nachvollziehen, dass viele Gesundheitsämter lieber beim bewährten und vielbespotteten Fax bleiben als auf dem Höhepunkt einer pandemischen Krise eine unerprobte und in funktionierende Abläufe erst noch zu implementierende Technologie einzuführen.
Aber das ist nur die eine, die technische Seite der Wahrheit. Die andere ist die politische. Hin und wieder gibt es, in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, Vorfälle, die ein Schlaglicht werfen auf das Verhältnis dieser Bundesregierung zur „Digitalisierung“. Um die „Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben“ hat der Bund auf Betreiben des Gesundheitsministers die Mehrheitsbeteiligung an einer einschlägigen IT-Firma erworben – kein schlechter Ansatz, sich auf diese Weise IT-Kompetenz ins Haus zu holen. Geschäftsführer der Firma wurde, nach kräftiger Anhebung des Gehalts, ein gelernter Internist, praktizierender Pharmalobbyist und, wichtiger noch, langjähriger Bekannter des Bundesgesundheitsministers, mit dem er kurz zuvor noch private Immobiliengeschäfte abgewickelt hatte, deren knapp siebenstellige Höhe zu nennen dieser den Medien gerichtlich verbieten ließ – das Ganze mitten in der Corona-Krise übrigens, von der man doch annehmen möchte, dass sie die Aufmerksamkeitsressourcen eines Bundesgesundheitsministers hinreichend in Anspruch nehmen sollte.
Aber es geht auch anders herum: Für den Gesamtkomplex der Digitalisierung ist in der Bundesregierung eine Staatsministerin Dorothee „Doro“ Bär zuständig, Berufspolitikerin und studierte Politologin. Anfang des Jahres 2021 wurde bekannt, dass deren Büroleiterin, nebenbei noch Lebensgefährtin des Bundesverkehrsministers, von einem Tag auf den anderen, also offensichtlich ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, zur weltweit bekannten und sicher deutlich besser zahlenden IT-Firma „facebook“ wechselte, unter Mitnahme des vertraulichen Insiderwissens der Bundesregierung, das man in einer solchen Schlüssel-und Vertrauensposition nun einmal erwirbt. Was soll man dazu sagen? Altpreußischen Vorstellungen von korrekter Amtsführung entsprechen solche Praktiken nicht. Sie helfen aber dabei zu verstehen, warum so vieles von dem schief geht, was die Bundesregierung anfasst.
Die „Digitale Schule“
Es sind einfach Hirngespinste, wenn man glaubt, dass das, was bei rund 380 Gesundheitsämtern nicht funktioniert, problemlos in 32 332 allgemeinbildenden Schulen möglich sei. Nachdem die Staatsministerin für Digitalisierung das Thema „Corona-Warn-App“ hinter sich gelassen hatte, wendete sie sich einem neuen Projekt zu: „So gelingt Schule digital“, verspricht sie im November 2020. Sie meint, einen „historischen Wandel“ der Schule einleiten zu können und wünscht sich, dass „wir weltweit ein Schulsystem haben, das auch ausländische Schüler zu uns nach Deutschland bringt.“ Nun kann man nicht wirklich sagen, dass die deutschen Schulen ausgerechnet unter einem Mangel an ausländischen Schülern litten, und wie „wir“ ein „weltweites Schulsystem“ haben können, versäumt die Digitalisierungsstaatsministerin zu erklären.
Aber egal: Auf jeden Fall wird die „Digitale Schule“ der Zukunft „agil, innovativ, international, partizipativ, vernetzt, hybrid, selbstregulativ, projektbezogen“ sein, verspricht die Staatsministerin in einem trübseligen Webauftritt, der nicht nur die Ahnungslosigkeit, sondern auch die Lustlosigkeit und Gleichgültigkeit der Bundesregierung gegenüber den Herausforderungen der „Digitalen Schule“ zeigt.
Neu ist das alles ohnehin nicht. Solche Diskussionen und Versprechungen hat es, oft fast wortgleich, schon vor zwanzig Jahren, um die Jahrtausendwende, gegeben. Der Bundesregierung waren damals durch die Versteigerung der UMTS-Frequenzen einige Milliarden Euro in den Schoß gefallen, die umgehend in die „Digitalisierung der Schule“ investiert werden sollten – daraus wurde dann nichts, aber immerhin fielen 50 Millionen für den „Kampf gegen rechts“ ab. 16 Jahre später gab es dann erneut eine Fünf-Milliarden-Initiative „Schulen ans Netz“, elegant „DigitalPakt#D“ genannt, seitens der Bundesbildungsministerin Wanka. Auch daraus ist wohl nicht viel geworden, denn Wankas Nachfolgerin Karliczek, immerhin gelernte Bank- und Hotelfachfrau, lobte bald darauf wiederum fünf Milliarden Euro für einen „Digitalpakt Schule“ aus, der orthographisch weniger ambitioniert daherkommt als der der Vorgängerin, aber ebenfalls nicht mehr zu bieten hat: Auch diese „Digitale Schule“ besteht aus W-Lan und Whiteboards für alle Schulen. Weiter reicht die Phantasie kaum, und was darüber hinaus geht, die „HPI Schul-Cloud“ des Hasso-Plattner-Institutes, die „schul.cloud“ von der stashcat GmbH, „Office 365 Education“ oder das runde Dutzend an Insellösungen, welche die einzelnen Bundesländer eingeführt haben, sind auch einfach nur Messenger mit Dateiablage mit mehr oder weniger umstrittener Datenschutzaffinität.
Weit gekommen ist man mit der „Digitalen Schule“ in den vergangenen beiden Jahrzehnten nicht, und das Beste an diesen Pakten und Initiativen ist, dass aus ihnen nichts wurde. Das wird auch diesmal nicht anders sein – trotz Corona. Denn viel mehr als eine durch die Umstände erzwungene Intensivierung des Fernunterrichts – auf Deutsch: distance learning –, wodurch übrigens die ganzen Whiteboards und W-Lans in den Schulen erst einmal Makulatur wurden, hat es nicht gegeben.
Erst recht wurden die eigentlichen Fragen nicht beantwortet, die eine „Digitale Schule“ aufwirft. Die großen Visionen von der „Digitalen Schule“ stammen ohnehin weniger von Pädagogen als vom internationalen IT-Business. Es sind Visionen, die sich an der Leitlinie des technisch Denkbaren und kommerziell Wünschbaren bewegen. Das Versprechen ist immer das Gleiche: Erleichterung und gleichzeitig Optimierung des Lernens.
Mit möglichst geringem Aufwand einen möglichst großen Effekt zu erzielen, ist im Geschäftsleben sicher ein richtiges Prinzip. In der Pädagogik funktioniert das aber nicht. Bildung und Erziehung sind etwas anderes als das Optimieren von Lernprozessen. Kritische Stimmen, die vor den pädagogischen Folgeschäden einer besinnungslosen Digitalisierung und vor der Unterwerfung unter kommerzielle Lobbygruppen warnen, werden an den Rand gedrängt. Den Marketingabteilungen der Anbieter ist es vielmehr gelungen, die Diskussion auf technische und allenfalls noch datenschutz‑ und urheberrechtliche Aspekte einzudampfen – von Pädagogik keine Spur mehr. Die anthropologischen und sozialen Tiefendimensionen sind in der Diskussion über die „Digitale Schule“ ohnehin noch gar nicht berührt. Aber auf die kommt es an. Denn digitale Lernprozesse schleppen Merkmale mit sich, von denen man kaum ahnt, welche Folgewirkungen sie haben werden und wie diese zu bewerten sind: Die Marginalisierung der Schrift, der Handschrift zumal, die Umcodierung vom Text zum Bild als herrschendem Symbolsystem, die Flüchtigkeit des Geschriebenen, der Zerfall von Wissensordnungen und die Entwertung von Wissensbeständen, die Transformation der Arbeitshaltungen von linearer Zielorientierung zur bricolage-Technik sind Entwicklungen, welche längst schon begonnen haben, nicht nur die Schule, sondern auch die Gesellschaft zu verändern. Ob die Schule das fördern oder dem entgegenwirken soll, ist eine noch offene Frage.
Eine vielbeschworene Gefahr allerdings scheint nicht zu bestehen: Das Nationale Bildungspanel hat in einer Befragung vom September 2020 untersucht, wie „Eltern mit Kindern in der 8. Klasse die Zeit der Schulschließungen erlebt haben“. Die Untersuchung hat den vielfach erhofften Skandal der sich „ständig weiter öffnenden Bildungsschere“ durch die Digitalisierungszwänge der Corona-Krise nicht erbringen können, sondern kommt zu ganz entspannten Ergebnissen: Weder die heimische Ausstattung mit den fürs Lernen benötigten digitalen Geräten noch die Fähigkeit damit umzugehen, sind vom akademischen oder nicht-akademischen Bildungshintergrund der Eltern abhängig. Das hätte man sich denken können.
Das Digitalisierungsparadox: Isolation durch Kommunikation
Einer Universitätsdisziplin wie der empirischen Bildungsforschung, die das Fliegenbeinzählen zur Wissenschaft erhoben hat, kann man es nicht verübeln, dass sie die grundlegenden pädagogischen Fragen einer „Digitalen Schule“ gar nicht erst stellt. In weiten Teilen der Bildungsdiskussion ist keine Vorstellung mehr davon vorhanden, worum es eigentlich in der Schule geht. Auch hier haben die Pisa-Studien ganze Arbeit geleistet. Mit ihrer flächendeckend durchgesetzten „Output“-Orientierung lassen sie nur noch die Frage zu, was am Ende einer mehrjährigen Schulzeit herausgekommen sein mag, während sie gleichzeitig den Blick davon abgewendet haben, was wirklich in der Schule passiert.
An bildungswissenschaftlichen Universitätslehrstühlen gerät man, fernab von der schulischen Wirklichkeit, ins Schwärmen, wenn man an die „Schule der Zukunft“ denkt: Jetzt endlich sei „adaptiver Unterricht“ möglich, der inhaltlich, didaktisch und methodisch ganz und gar an den je individuellen Lernenden angepasst ist. Jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen – jeder erhalte sein „personal learning environment“; „intelligente tools“ – damit sind offensichtlich nicht Lehrer gemeint – unterstützen jeden einzelnen Schüler, unablässig werden nicht nur Datenströme mit Schülerleistungsdaten an die am Backend sitzenden Lehrkräfte weitergeleitet, nein, die „kognitive Aktivität“ der Kinder lässt sich an ihren Gehirnströmen abmessen, sodass jede Abweichung sofort mit einer neuen Konditionierungsschleife zurechtgerückt werden kann. Denn dass Menschen genauso programmierbar sind wie Computer, gehört zum Ausgangscredo digitaler Pädagogik, die damit auf elegantere Weise das Erbe der grobschlächtigen Versuchsanordnungen eines Pawlow oder Skinner antritt.
In solchen pädagogischen Visionen kommt einiges zusammen: Es ist nicht mehr nur der Orwell-Kosmos allseitiger Überwachung und auch nicht nur der Huxley-Kosmos einer „schönen neuen Welt“ der Selbstoptimierung. Hinzu kommt der Skinner-Kosmos der konditionierten Persönlichkeit. Der Verhaltenspsychologie B. F. Skinner hat, wie Orwell im gleichen Jahr 1948, einen utopischen Roman „Walden II“ geschrieben – auf Deutsch „Futurum II“ –, der mit dem verheißungsvollen Satz endet: „Die Welt war in Ordnung“, in Ordnung gebracht von Verhaltenspsychologen und Lerntechnokraten, welche ihre Probanden so lange herumkonditionieren und manipulieren, bis sie so sind, wie sie sein sollen. Die Menschen, die aus einer solchen „Schule der Zukunft“ hervorgehen, werden ihrer eigenen Unterwerfung sicher noch freudiger zujubeln als es die Zeitgenossen jetzt schon tun.
In dieser „Schule der Zukunft“ werden alle Bezüge zur Kulturtradition abgeschnitten und ersetzt durch jenes global gültige Symbolsystem, das sich der digitale Kosmos selbst geschaffen hat: Emojis lösen die Sprache ab, politische korrekte Netflixserien ersetzen literarische Traditionen, Buchstabenketten wie FFF, BLM, LGBTQ, international nicht minder verständlich wie BMW, VW oder DHL, lösen bedingte Reflexe aus, die an die Stelle politischer Auseinandersetzungen treten, Cancel Culture-Aktivisten fegen die verbliebenen Reste komplexer Kulturtraditionen hinweg und beseitigen damit die letzten Hemmnisse, die dem Geschäftsmodell der „Digitalen Schule“ entgegenstehen, in der nichts so störend ist wie Komplexität, Uneindeutigkeit, Einmaligkeit, Individualität und sperrige Traditionen mit ihrer Widerständigkeit gegen den Zeitgeist.
Jeder lernt für sich allein in dieser traurigen „Schule der Zukunft“. Jeder Schüler sitzt in seiner virtuellen Lernkabine und starrt, abgekapselt von der realen Welt, auf seinen Bildschirm, eingesperrt in das Gehäuse digitaler Hörigkeit, eine amorphe Masse atomisierter Individuen, von denen jedes seinen eigenen Lehrplan absolviert hat, sodass nichts Gemeinsames übrig bleibt – kein Lektürekanon, keine Bildungserfahrungen, über die man sich verständigen könnte, keine Erfolgs- und keine Misserfolgserlebnisse, über die man sich mit anderen ärgert oder freut, keine Lehrer, an denen man sich abarbeiten kann – nur freundliche Maschinen. Diese Visionen einer digitalen „Schule der Zukunft“ treiben das Digitalisierungsparadox auf die Spitze, jenes Paradox, dass ausgerechnet die avancierteste Kommunikationstechnologie zur radikalen Atomisierung des einzelnen Schülers führt.
Aber so wird es nicht kommen. Schulzeit ist Lebenszeit und die Schule ist eine mühsam der Geschichte abgerungene Lebensform, die man sich so schnell nicht nehmen lässt. Vielleicht wird die Corona-Krise am Ende doch noch zum Glücksfall für die Schule: Nicht weil sie die Digitalisierung beschleunigt, sondern weil sie dazu geführt hat, dass Schüler und Lehrer wieder gerne zur Schule gehen – schulgeschichtlich ein einzigartiger Vorgang.