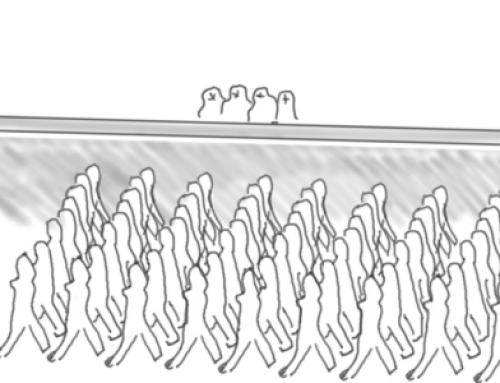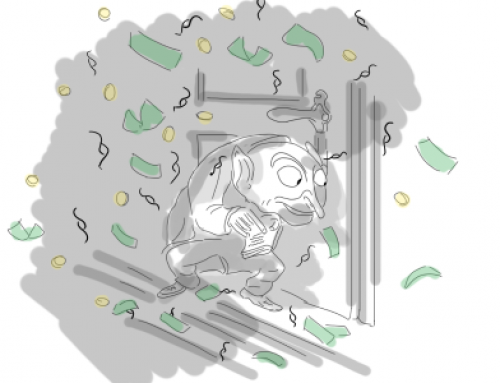Alles Theater
Genau betrachtet war es nur ein Sturm im Wasserglas des deutschen Empörungstheaters: 1400 „Theaterschaffende“ – genauer gesagt: Beschäftigte im Umfeld deutscher Theaterbetriebe – haben in einem Offenen Brief erklärt, dass sie beleidigt sind. Beleidigt sind sie, weil einem der ihren eine rassistische Kränkung widerfahren ist. Der Vorgang ist von jener bestrickenden Schlichtheit, welche die deutsche Empörungskultur auszeichnet und er liegt, auch das gehört dazu, schon einige Zeit zurück. Ein Ensemblemitglied des traditionsreichen „Düsseldorfer Schauspielhauses“, das sich inzwischen modisch „D’haus“ nennt – aber immer noch an einem Platz residieren darf, der nach einem Göring-Protegé und NS-Kulturschaffenden benannt wurde – hat sich am 21. März 2021 beklagt, dass er während der Proben zur Inszenierung von „Dantons Tod“, die am 20. September 2019 Premiere hatte, rassistisch beleidigt worden sei und dass überhaupt „rassistische und sexistische Strukturen“ am „D’haus“ herrschten.
Die von ihm benannten Vorfälle scheinen unstrittig zu sein; ob und in welchem Umfang es sich hier um Rassismus handelt oder nur um Ausdrucksformen schlechter Manieren unter Schauspielern, liegt im Auge des Betrachters. Aber darüber lässt sich heute nicht mehr diskutieren. Die Empörung wäre auf jeden Fall unvermeidlich gewesen. Dass sie noch größere Wellen geschlagen hat als bei solchen Routinevorfällen üblich, hängt damit zusammen. dass jemand ihr öffentlich widersprochen hat – und zwar nicht jemand vom „rechten Rand“, sondern ein erfahrener Theatermann, Professor für Theatergeschichte und Dramaturgie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und Dramaturg des nicht ganz unbedeutenden „Berliner Ensembles“.
Bernd Stegemann also hat mit bewundernswerter Geduld in einem Artikel der „Frankfurter Allgemeinen. Zeitung für Deutschland“ vom 9. April 2021 klarzumachen versucht, dass im Theaterbetrieb bestimmte Regeln herrschen, an die sich halten sollte, wer an diesem Betrieb freiwillig teilnimmt. Im Kern liefen seine Hinweise auf den alten Rat hinaus, den man früher Schulabgängern mit auf den Lebensweg gegeben hat: „Augen auf bei der Berufswahl“, und nicht minder wertvoll war in solchen Fällen die Empfehlung, dass nicht Koch werden solle, wer die Hitze nicht verträgt.
Diese Hinweise hätte Stegemann besser unterlassen. Stegemann ist in dem Milieu, in dem er sowohl beruflich wie politisch zu Hause ist, von einem Verdachts- zu einem Beobachtungsfall geworden. Mehrfach hat er dem Homogenitätsdruck und den Unterwerfungsimperativen widerstanden, die im Cancel-Culture-Betrieb herrschen und die ihre Wirkungen weit darüber hinaus, in die gesamte Gesellschaft hinein, entfalten. Im Februar 2021 hat Stegemann sein Buch „Die Öffentlichkeit und ihre Feinde“ publiziert. Er legt mit profunder Sachkenntnis und hochreflektiert die Mechanismen des öffentlichen Empörungsbetriebs dar, zu dessen elementaren „Grundemotionen“ eine „Gereiztheit und Gekränktheit“ gehören, die sich zu einer „zänkischen Öffentlichkeit“ verdichtet haben. Die Reaktionen auf seinen Zeitungsartikel lieferten, wie in solchen Fällen üblich, die Probe aufs Exempel seiner Beobachtungen.
Die Erniedrigten und Beleidigten
Von seiner Intervention fühlten sich offensichtlich mehr betroffen, als ursprünglich gemeint waren. Initiiert von vier „Theaterschaffenden“ folgte Stegemanns Artikel der „Offene Brief“, der zunächst von 1400 weiteren Mitgliedern des Kulturbetriebs unterschrieben wurde. Was genau sie mit ihrem vielseitigen Schreiben ausdrücken wollen außer ihrer Empörung, ist schwer zu sagen. Denn das Schreiben ist mit jenen Chiffren des Insiderjargons verschlüsselt, die den Text für Außenstehende fast unverständlich machen. Bertolt Brecht hat Ende der 1920er Jahre ein beiläufiges Gedicht geschrieben mit dem schönen Titel: „700 Intellektuelle beten einen Öltank an“. Das Manifest der Theaterschaffenden könnte analog dazu die passende Überschrift tragen: „1400 Intellektuelle beten sich selbst an“. Das Gedicht enthält jedenfalls die passenden Zeilen: „Lösche aus unser Ich! | Mach uns kollektiv!“
Aber so viel ist klar: Einen wie Stegemann wollen sie in ihren Reihen nicht dulden. Immerhin wird Stegemann zu einer Diskussion eingeladen, deren Eintrittsbillett eine vorgängige Unterwerfungserklärung ist: Bevor man mit ihm reden könne, möge er doch bitte einsehen, dass sein Konzept der „Freiheit der Kunst“ veraltet sei. Nun ist es denkbar, sogar wahrscheinlich, dass die Verfasser der Erklärung nicht wirklich wissen, was sie damit sagen. „Freiheit der Kunst“ ist immerhin eine der Grundrechtsgarantien des deutschen Grundgesetzes, mit deren Hilfe nicht zuletzt die Fleischtöpfe gefüllt werden, von denen sich große Teile des deutschen Schauspielgewerbes nähren.
Das Schreiben der 1400 war nur der Prolog. Der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses formuliert umgehend, ebenfalls in der „Frankfurter Allgemeinen“ vom 17. April 2021, eine Unterwerfungserklärung, in der gleich sechsmal das Zauberwort der „Struktur“ fällt, die man künftig im „D’haus“ verbessern wolle. Obwohl er mit den Vorgängen nichts zu tun hatte und sich weder einen juristischen noch einen moralischen Vorwurf machen lassen muss, gilt auch für ihn wie für jeden anderen der Leitsatz aus Kafkas „Strafkolonie“: „Die Schuld ist immer zweifellos“.
Der Regisseur schließlich, der massiv mit Rassismus-Vorwürfen bedacht worden war, hat sich vernünftigerweise weitgehend zurückgehalten. Immerhin lässt er sich von einem befreundeten Kollegen, dem Generalintendanten am Theater Bremen, auf dessen Website nicht nur das Leumundszeugnis ausstellen, dass er doch eigentlich und in Wirklichkeit kein Rassist sei, sondern lässt ihn auch einen längeren Auszug aus einer privaten E-Mail an den erniedrigten und beleidigten Schauspieler zitieren: „Vielleicht noch einfacher gesagt, es reicht heute nicht mehr, nur kein Rassist zu sein, es geht darum, sich antirassistisch zu verhalten und das so auch permanent zu kommunizieren. Mit Worten, Gesten, Bildern, eigenem Verhalten und zwar egal wo, genauso in der Umkleide wie am Kaffeeautomaten oder auf der Probe. In diesem Lernprozess befinde ich mich zurzeit.“ So soll es sein und so wird es künftig sein.
Das alles war vorhersehbar wie der Gang der Gestirne und man könnte glauben, damit hätten die Empörten ihr Ziel erreicht und sie könnten sich einem neuen Objekt ihrer Empörungsbegierde widmen.
Neu und originell – aber doch auch irgendwie vorhersehbar – war die Posse, die der Komödie vorangegangen war: „Zweiundzwanzig (22) Schwarze“ – und nicht etwa schwarze – „Theatermacher:innen und Theatermacher:innen of Color“ haben am 29. März 2021 die Konsequenz gezogen aus der offenbaren Unzumutbarkeit, in einem Schauspielhaus arbeiten zu müssen, dessen rassistische Strukturen die permanente Gefahr einer Retraumatisierung bergen. Die Konsequenz liegt auf der Hand: Sie wollen ein eigenes Theater haben, „als aktive Möglichkeit uns dem institutionellen Rassismus zu entziehen“. (Auf ein Komma mehr oder weniger kommt es nicht an, wenn es ums Ganze geht.) Damit könnte sich das Land Nordrhein-Westfalen, an das die Forderung gerichtet ist, billig von seiner Schuld loskaufen; gefordert wird schließlich nur „das Freistellen eines Subventionsvolumens von 600.000-800.000 Euro jährlich für eine mindestens vierjährige Planungssicherheit“. So viel Unverfrorenheit mitten in der Corona-Krise, in der Tausende von Schauspielern und anderen Künstlern um ihre Existenz fürchten müssen, verdient auch schon wieder Bewunderung. Und natürlich stehen sie mit ihrer Forderung nicht allein. Das Schreiben wurde inzwischen von rund 25000 Menschen aller Art unterzeichnet.
Es gehört zur guten deutschen Tradition, dass man das Theatervölkchen mit einer gewissen Gutmütigkeit betrachtet und ihm manches durchgehen lässt. So kann es durchaus sein, dass die Forderung erfüllt wird. Die deutsche Theater- und Opernlandschaft ist ein hochsubventionierter und schwer überschaubarer Betrieb mit rund 40 000 angestellten Mitarbeitern, die nach Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes beschäftigt sind. Die jährlichen Subventionen aus Mitteln der öffentlichen Hand belaufen sich auf 2 bis 2,5 Milliarden Euro, da kommt es auf 800 000 Euro für einen guten Zweck auch nicht mehr an. Eine politische Lehre immerhin lässt sich daraus ziehen: Wenn man antirassistischen Aktivisten den kleinen Finger reicht, wollen sie mehr als nur die ganze Hand.
Hier werden Ansprüche an den deutschen Steuerzahler gestellt, die durch nichts anderes gerechtfertigt werden als durch die Hautfarbe der Antragsteller. Man könnte die Frage stellen, wo das alles hinführen soll, aber die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Im September 2020 berichtete die „Neue Zürcher Zeitung“, dass in Hollywood die Regeln für künftige Oscar-Verleihungen geändert wurden: „Der Beschluss sieht vor, dass Hauptdarsteller oder wichtige Nebendarsteller einer ethnischen oder sexuellen Minderheit angehören müssen. Sind die Hauptdarsteller weiss und heterosexuell, müssen mindestens 30 Prozent der Darsteller von Nebenrollen entweder weiblich sein oder ethnischen bzw. sexuellen Minderheiten angehören. Ausserdem muss die Filmhandlung Anliegen unterrepräsentierter Gruppen enthalten. Dieselben 30 Prozent gelten auch für Angestellte des Kreativteams (Regie, Produktion, Drehbuch) sowie im Bereich genereller Arbeiten, der Praktika und im Marketing.“ Deutschland darf sich allerdings rühmen, dem amerikanischen Vorbild diesmal voraus zu sein. In Deutschland gibt es gleich mehrere Agenturen, welche Schauspieler nach Hautfarbe, ethnischen und diversen anderen Eigenschaften sortiert anbieten, um auf diese Weise „mehr Vielfalt“ in die Fernseh‑, Theater- und Kinoprogramme zu bringen. Den Erfolg dieser Mühen ist bei jedem beliebigen Spiel‑ und erst recht jedem Kriminalfilm im Volkserziehungsprogramm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu beobachten.
Wie kommt der Sklave auf die Bühne?
Über die Opfer dieser Düsseldorfer Affäre ist viel geredet worden und sie selbst haben sich am lautesten ins Gerede gebracht. Aber das eigentliche Opfer hat keine Stimme mehr. Es heißt Georg Büchner.
Der Schauspieler, welcher sich während der Proben zu Büchners „Dantons Tod“ beleidigt gefühlt hatte, spielte die Rolle des ehemaligen Sklaven Toussaint Louverture. Die Beleidigung bestand wohl, soweit man das als Außenstehender überhaupt begreifen kann, im Wesentlichen darin, dass er auch am Rande der Proben hin und wieder mit dem Bühnennamen „Sklave“ angesprochen wurde. Darüber ist nun viel geredet worden. Die interessanteste Frage hat allerdings niemand gestellt: Wie kommt ein Sklave in „Dantons Tod“? Der Autor des Stückes, ein junger weißer Mann namens Georg Büchner, wusste davon noch nichts. Denn der Sklave ist eine Zutat des Regisseurs. Was immer er sich dabei gedacht hat – man kann es sich denken. Denn der neu ins Stück gekommene Sklave Toussaint Louverture ist eine historische Figur, Initiator der Revolution in Haiti, die Anfang 1804 zur Befreiung der Sklaven und zur Unabhängigkeit des Landes von Frankreich führte. Um es allen recht zu machen, brachte der Düsseldorfer Regisseur mit Olympe de Gouges, einer frühen, 1793 hingerichteten Frauenrechtlerin, eine weitere nicht zum Drama gehörende Figur auf die Bühne. Damit war Büchners Drama den aktuellen Zeitläuften angepasst und hinreichend nach wenigstens zwei Seiten abgesichert.
Büchner war ein politischer Autor, zweifellos. „Dantons Tod“ erschien 1835 in gedruckter Form in einer aus Zensurrücksichten geänderten Fassung; aufgeführt wurde das Drama erst 1902. Es gibt gute Gründe, das Drama heute auf die Bühne zu bringen, denn manche Parallelitäten zum heutigen Zeitgeist sind augenfällig. Der tugendhafte Kleinbürger Robespierre, dessen finales Argument die Guillotine ist, und der Hedonist Danton stehen sich in Büchners Drama gegenüber. Büchner lässt beide, dem Gang der historischen Ereignisse folgend, zu Opfern ihrer eigenen Revolution werden.
Georg Büchner war wach, aber nicht „woke“. Mit seinem „Woyzeck“ und mit „Dantons Tod“ hat er das deutsche Drama revolutioniert, und revolutionär war er auch mit seinem Aufruf „Friede den Hütten, Krieg den Palästen“. Man kann seinen „Danton“ heute als eine Parabel lesen für jenen hegemonialen Typus des deutsch-europäischen Bürgertums, das sich gerade anschickt, neben der kulturellen auch die politische Macht zu ergreifen.
Danton erscheint bei Büchner als hedonistischer Schöngeist, der „ein schönes Haus“ hat und „von silbernen Tellern“ isst, ansonsten vor sich hinphilosophiert, während um ihn herum die Welt in Flammen aufgeht, die er selbst entzündet hat und die ihn am Ende verschlingen werden. Heute müsste man ihn als mülltrennenden SUV-Fahrer mit Elektrozweitwagen auf die Bühne bringen. Eine Aufführung, die das Stück in dieser Weise ernst nähme, könnte sich manche Verdienste zur Aufhellung gegenwärtiger Verhältnisse erwerben.
Aber von den aktuellen Befindlichkeiten des Zeitgeistes handelt das Stück nicht, nicht von Klimawandel und Cancel Culture, nicht von Sexismus und LGBTQ+, nicht von strukturellem Rassismus und Gendersternchen. Wer das haben will, sollte sich ein anderes Stück suchen oder selbst eins schreiben – die Ansprüche wären nicht allzu hoch. Die 22 Schauspieler, die auf so gewinnende Art ihre Forderungen an den deutschen Staat zu stellen wussten, haben sich zusammengefunden, so erklären sie, im Bündnis des Bühnenstücks „Afrokultur“ (inklusive des Musikensembles Vivace Più) und des Empowerment-Theaters „M(a)y Sister – unter einem alten Walnussbaum“. Diese Produktionen werden ihre Qualitäten haben, die nur beurteilen kann, wer dabei gewesen ist. Unbesorgt wird man aber vermuten dürfen, dass diese Qualitäten nicht an die eines Dramas von Georg Büchner heranreichen.
Die Frage stellt sich durchaus: Wer richtet mehr kulturelles Unheil an – der Cancel-Culture-Aktivist, der Straßenschilder abschraubt und Denkmäler in Hafenbecken stürzt oder der Theaterschaffende, der sich an fremdem Kulturgut vergreift und es seinen Zwecken dienstbar macht?
Büchner gehört zum kulturellen Erbe der deutschen Literatur, und dieses literarische Erbe steht nicht jedem zur Verfügung. Cultur-Cancel-Aktivisten und Gendersprachakrobaten haben keinen Anspruch auf die Teilhabe an diesem kulturellen Fundus. Ihnen darf Büchner nicht als Beutekunst überlassen werden.