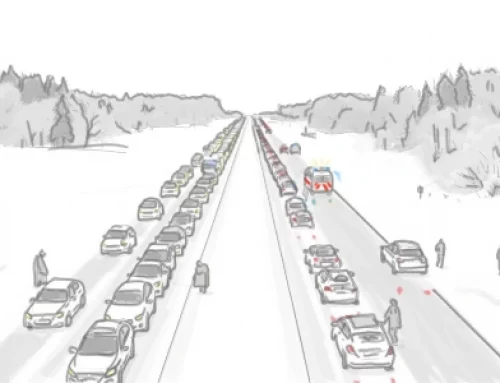Die Schultüte
„Allem Anfang wohnt ein Zauber inne“, heißt eine vielzitierte Gedichtzeile aus dem Altbestand des bürgerlichen Bildungskanons. Das gilt sicherlich für den Schulanfang. Mit dem September sind nun auch die letzten, die bayerischen Schulanfänger in ihren Klassenräumen angekommen. Für sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt, und man möchte hoffen, dass die Erstklässler dem Schulanfang mit freudiger Erwartung entgegensehen.
Wahrscheinlich sind die meisten Schulanfänger wirklich froh, dass für sie ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Für diesen „Übergang“, wie es in der Fachwelt der Pädagogen heißt, haben sich Rituale entwickelt, die seit dem 19. Jahrhundert erstaunlich stabil geblieben sind. Das sichtbare Symbol ist die Schultüte, die den Kindern den Schuleintritt buchstäblich versüßen soll. Die Schultüte gibt es immer noch flächendeckend. Auch wenn ihr Inhalt, wie man hört, oft mit elektronischen Geräten aufgerüstet wird, bleiben doch die Süßigkeiten der Kern des Ganzen. Diese „Schultüte“ sollte man nicht unterschätzen. Sie ist ein altes Ritual, das erstaunlicherweise die Zeiten überdauert hat, während die deutschen Schulen fast durchgehend dabei sind, tradierte identitätsstiftende Bräuche wie Martinszüge, Weihnachtsfeste, christliche Lieder und Schulgottesdienste auf dem Altar interkultureller Sensibilität zu opfern.
Dass Kinder Anspruch auf eine Schultüte haben, ist übrigens gerichtlich geklärt: Höchstrichterlicher Rechtsprechung folgend, hat das Sozialgericht Schleswig im August 2006 entschieden, dass die Arbeitsverwaltung die Kosten für eine Schultüte erstatten muss, obwohl die Mutter monatliche Beihilfepauschalen für solche Zwecke erhielt, die sie aber nicht angespart hatte. Damit wäre auch das geklärt.
Der Übergang
Die genauen Zahlen der Schulanfänger liegen noch nicht vor. Es ist anzunehmen, dass sich der Trend der vergangenen Jahre fortsetzt. Im Schuljahr 2023/24 gab es so viele Einschulungen wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. 830 600 Kinder wurden eingeschult, das waren gut 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Wer die bildungspolitische Diskussion der jüngeren Zeit noch vor Augen hat, wird sich amüsiert daran erinnern, dass man vor eben diesen zwanzig Jahren Panik geschürt hat wegen sinkender Schülerzahlen und leerstehender Schulen. Dass es aber so kommen würde, wie es jetzt gekommen ist, konnten auch die skeptischsten Beobachter nicht vorhersehen. Die Schule steht jetzt vor Herausforderungen, die historisch einzigartig sind, und diese Herausforderungen beginnen nicht erst mit dem Schulanfang.
„Übergänge“, der institutionalisierte Wechsel von einer Ebene des Bildungssystems zur nächsthöheren, sind ein altes Thema der Schulpädagogik. Schließlich handelt es sich um einen gravierenden Einschnitt, mit dem eine neue Lebensphase beginnt. Beim „Übergang“ vom Vorschulalter in die Schule wird, der Theorie nach, das Kind aus der Obhut der Familie entlassen und erstmals mit einer gesellschaftlichen Institution, eben der Schule, konfrontiert. Es handelt sich um ein hochkomplexes Problemfeld, bei dem sich individual- und entwicklungspsychologische, pädagogische, soziale, politische und vor allem auch institutionelle, organisatorische und finanzielle Fragestellungen und Herausforderungen ineinander verschlingen.
Seit den 1950er Jahren macht man sich Gedanken darüber, wie sich das am besten gestalten lässt. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Überlegung durchgesetzt, dass Übergänge möglichst nicht disruptiv, sondern gleitend gestaltend werden sollten, um biographische Brüche und Überforderungen zu vermeiden. Eine schwindelerregende Fülle von Maßnahmen wird empfohlen, um den „Übergang“ zu meistern. Pädagogischer Klugheit entspringt diese Abdämpfungspädagogik nicht. Denn solche Einschnitte gehören nun einmal in den Lebensverlauf, und eine Pädagogik, die durch administrative Maßnahmen die Krisen zu „gleitenden“, harmonischen Übergängen umgestalten will, macht nicht nur ein unhaltbares Versprechen, sondern verfehlt zugleich den Sinn von Schule. Mit dieser Art vorauseilender Fürsorge nimmt man dem Kind die Möglichkeit, den Schuleintritt als etwas klar von der Vorschulphase Abgegrenztes und Neues, eben als einen neuen Lebensabschnitt, zu erfahren.
Vom „Philippinenmaß“ zum „Screening“
Eng verbunden mit der Frage des Übergangs ist die Frage der Schulreife. Einerseits muss sie aus unabweisbaren organisatorischen und institutionellen Erwägungen immer auch möglichst einheitlich, nämlich mit Blick auf ein allgemeines Einschulalter festgelegt werden. Andererseits aber muss sie für jedes Kind, je nach seinem kognitiven, physischen, emotionalen und sozialen Entwicklungsstand, anders beantwortet werden – ganz zu schweigen von den manchmal sehr speziellen Vorstellungen, die Eltern von den Fähigkeiten oder Unfähigkeiten ihrer Kinder haben. Diese Diskussionen werden seit Jahrzehnten geführt und haben insgesamt zu einer alltagstauglichen Praxis geführt
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man das charmante „Philippinermaß“ als Merkmal der Schulreife benutzt: die Fähigkeit eines Vorschulkindes, mit den Fingerspitzen einer Hand über den Scheitel hinweg das Ohr der gegenüberliegenden Körperseite zu erreichen. Das reicht heute nicht mehr; nicht nur deshalb nicht, weil sich im Laufe des 20. Jahrhunderts die Körpermaße und ‑proportionen von Kindern verändert haben, sondern auch, weil ein so einfaches Merkmal wenig Beschäftigungsmöglichkeiten für Schulpsychologen bietet. Ohne ein flächendeckendes „Screening“ aller Vorschulkinder wird es in Zukunft wohl nicht mehr gehen. Heute würde das „Philippinermaß“ wahrscheinlich ohnehin als rassistisch gebrandmarkt werden.
Aktuell stellen sich ganz andere Herausforderungen an das Konzept „Schulreife“. Im August 2024 wurde der wenig beachtete Befund zweier deutscher Schulministerien bekannt: In Nordrhein-Westfalen hat sich vom Schuljahr 2019/20 bis zum Schuljahr 2023/24 die Zahl der Zurückstellungen von der Einschulung um fast 80 Prozent, auf 5695 genehmigte Fälle, erhöht. In Sachsen-Anhalt ist ein ähnlicher Trend zu beachten. Hier wurden zuletzt 4,3 Prozent der rund 20 000 einschulungspflichtigen Kinder zurückgestellt. Entsprechende Zahlen aus anderen Bundesländern sind nicht bekannt, aber viel anders wird es dort auch nicht sein.
Warum das so ist, weiß man nicht so recht. Teils werden es überbesorgte Eltern sein, welche den Schuleintritt verzögern, aber es hat wohl doch auch tiefere Gründe. Schulpsychologen vermerken Defizite in der Fein‑ und Grobmotorik und emotionalen Bildung. Sie führen das vor allem auf die Corona-Jahre zurück, ebenso wie, das liegt auf der Hand, auf den zu frühen Gebrauch elektronischer Geräte. Beides hängt eng zusammen – wenn die sozialen Kontakte von Vorschulkindern von Staats wegen radikal eingeschränkt werden, darf man damit rechnen, dass sie diesen Mangel anderweitig kompensieren.
Das ist die eine neue Herausforderung für den Übergang in die Schule. Die andere heißt „Migration“. 2022 ist im einschulungsrelevanten Alter von 5 bis 7 Jahren der Anteil von Kindern mit ausländischer Staatsangehörigkeit gegenüber dem Vorjahr um 21,3 Prozent gestiegen. Das ist bildungspolitisches Dynamit. Dass immer mehr Vorschüler die deutsche Landessprache nicht beherrschen, ist eine Situation, die in der langen Tradition der Schulreifediskussion schlicht nicht vorgesehen ist. Offenkundig handelt es sich auch nicht um ein vorübergehendes Phänomen, das sich schnell auswächst. Man muss vielmehr damit rechnen, dass in größer werdenden Bevölkerungsteilen die deutsche Landessprache dauerhaft nicht die Familiensprache sein wird. Da hat es wenig Sinn, die Kinder ein Jahr zurückzustellen und auf die Schulreife zu warten. Es müssen massive Frühfördermaßnahmen ergriffen werden. In Bayern will man ab 2025 flächendeckende Sprachstandserhebungen im Kindergartenalter einschließlich einer Förderungspflicht durch einen „Vorkurs Deutsch“ einführen. Ob das wirksam sein wird und woher die personellen Ressourcen kommen werden, weiß niemand. Es ist eigentlich nicht überraschend, dass diese Schieflagen ein Folgeproblem nach sich ziehen müssen: der Lehrerberuf wird unattraktiver. Es werden immer mehr Lehrer gebraucht, und gleichzeitig ist die Zahl der Lehramtsstudienanfänger nicht nur rückläufig – viel bedrohlicher ist der Befund, dass knapp 50 Prozent der Lehramtsstudenten auf dem Weg vom Hörsaal zum Klassenzimmer aufgeben.
Schulunlust und der „Verlust der Kindheit“
Dass Lehrer keine Lust mehr haben, kann man verstehen, und bei Schülern gibt es das auch. Schulunlust, die sich bis zur Schulangst steigern kann, ist ein bekanntes Phänomen in der Pädagogik. Auch wenn Kinder anfangs gerne zur Schule gehen, müssen sie früher oder später erfahren, dass die Schule ihre Schattenseiten hat: Aus dem Spiel kann Arbeit werden, es werden Forderungen gestellt, die nur mit Mühe zu bewältigen sind, nicht jeder Klassenkamerad ist sympathisch, nicht zu reden von den Lehrern, zu deren Rolle es gehört, die Forderungen der Gesellschaft gegenüber den Schülern geltend zu machen. Das ist so, seit es Schule gibt, und daran lässt sich wenig ändern. Aber genau das versucht man ist langem schon zu verhindern oder zu verdrängen.
Die US-amerikanische Psychologin Jean Twenge hat bei der „Generation Z“, den zwischen 1995 und 2012 Geborenen, den Befund erhoben, dass sie später erwachsen und selbständig werden und dass sie stärker zu Depressionen bis hin zu Selbstverletzungen und Suizid neigen. Das verspätete Erwachsenenwerden führt sie zurück auf einen „Verlust an Kindheit“. Paradoxerweise besteht der Verlust darin, dass Jugendliche allzu lange als Kinder behandelt werden, sodass ihnen die Erfahrungen fehlen, die sie zum Erwachsenwerden brauchen. Schon die Schulkinder werden einer Kultur des safetyism, einer Überbehütung mit Safe Spaces und Triggerwarnungen ausgesetzt, die sie weitest möglich vor einer Konfrontation mit den unangenehmen Facetten der Wirklichkeit beschützt. Wohin das geführt hat, kann man inzwischen sehen.
Diese Generation ist an den Universitäten angekommen, und dort werden ihre Erwartungen weitgehend erfüllt. Die andere Hälfte eines jeden Jahrgangs, die keine Hochschulzugangsberechtigung erworben hat, muss sich entweder dem harten Alltag einer Berufsausbildung stellen oder sich ihm entziehen, was in der bundesrepublikanischen Wohlstandsgesellschaft aktuell durchaus noch möglich ist. 2022 gab es in Deutschland 630 000 junge Leute zwischen 16 and 27, die als „NEETs” in der Statistik geführt werden: „not in employment, education or training”.
Das hat Folgen. Der Kinderbuchautor Erich Kästner hat 1952 in seiner „Rede zum Schulanfang“ den Kindern den Rat gegeben: „Lasst euch die Kindheit nicht austreiben!“ Auf lange Sicht gesehen, ist sein Rat wohl erfolgreich gewesen: Sieben Jahrzehnte später sind Politiker an die Schalthebel der Regierungsmacht gekommen, welche die Welt mit Kinderaugen sehen und die sich der Wirklichkeit mit den Allmachtphantasien eines noch weltunkundigen Kindes nähern. Aber darüber sollte man sich nicht lustig machen. Kästner lässt den Rat folgen: „Lacht die Dummen nicht aus! Sie sind nicht aus freien Stücken dumm und nicht zu eurem Vergnügen.“ Sie haben es so in der Schule gelernt, möchte man hinzufügen.
Schule der Angst
Der deutsche Bundesernährungsminister, der sich seines eigenen Migrationshintergrunds rühmt, hat im September 2024 darüber geklagt, dass seine kurz vor dem Abitur stehende Tochter „von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft oder sexualisiert“ werde. Dass hinter dieser Einsicht, die er schon vor knapp zehn Jahren hätte haben können, nur die Angst vor dem nächsten Wahlergebnis steckt, merken inzwischen auch die grünsten aller Wähler. Um solche Erfahrungen zu machen, muss man übrigens nicht in Berlin wohnen. Im Februar 2024 konnte man die Meldung lesen, dass der Direktor einer Mädchenschule mitten im einst beschaulichen Regensburg vor den Gefahren des Schulwegs warnte, weil die Innenstadt „trotz erhöhter Präsenz von Polizei und Ordnungsdienst auch tagsüber Kriminalitätsschwerpunkte“ aufweist. Und nicht nur der Schulweg ist gefährlich. 2023 gab es 27 470 Gewaltdelikte in deutschen Schulen, ein Anstieg um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sicherheitsdienstleistungsangebote für deutsche Schulen sind inzwischen ein florierender Wirtschaftszweig geworden.
Aber davon ist nicht jeder betroffen. Man hätte den Ernährungsminister darauf hinweisen sollen, dass er am besten dorthin zieht, wo seine Kollegen und seine Wähler wohnen. Es gibt in jeder deutschen Stadt Wohnviertel, in denen man von den Folgen der eigenen Migrationspolitik auf den Straßen und auch in den Schulen verschont bleibt. Man muss sie sich nur leisten können. Aber auch in diesen besser behüteten Vierteln, in denen die Schüler keine reale Angst haben müssen, werden ihnen virtuelle Ängste eingebleut: das Verbreiten klimaapokalyptischer Zukunftsszenarien gehört inzwischen zum Standardrepertoire des schulischen Curriculums.
Es hätte nicht unbedingt der Balkendiagramme im „Schufa Jugend-Finanzmonitor 2024“ oder in der „Sinus-Jugendstudie 2024“ bedurft, um herauszufinden, was die jetzige Schülergeneration intuitiv erfasst hat: Die guten Jahre sind vorbei. Die Schüler wissen schon länger Bescheid über die Verhältnisse auf deutschen Straßen und Schulhöfen. Sie haben am stärksten unter der Corona-Politik gelitten, und sie haben auch eine Ahnung davon, dass die aktuelle Migrations- und Energiepolitik auf Kosten ihrer eigenen Zukunft, ihrer Sicherheit und ihres Wohlstandes ausgetragen wird. So kommt es eben, dass sie Parteien wählen, die sie nicht wählen sollen.
Die Schulanfänger des Jahres 2024 muss das alles noch nicht kümmern. Ihre Zukunft liegt noch vor ihnen, und sie können erst einmal mit ihren Schultüten im Arm wohlgemut ihre Klassenzimmer erkunden, die ersten Buchstaben erlernen und neue Freundschaften schließen. Und vielleicht tut es ihnen ganz gut, wenn sie im Laufe ihrer Schulzeit lernen, sich mit realen Problemen statt mit den Scheinproblemen der postmodernen Wohlstandgesellschaft auseinandersetzen zu müssen. Aber wie auch immer: Zu jeder Pädagogik gehört eine gehörige Dosis Optimismus – irgendwie geht es immer weiter und vielleicht wird ja noch alles gut.
***
Am Sonntag, 22. September 2024, wurde im „Kontrafunk“-Internetradio in der Reihe „Audimax – das Kontrafunkkolleg“ der Hörfunkvortrag
„Furchtbare Juristen“ –
ein deutscher Berufsstand im Wandel der Zeit
von Peter J. Brenner gesendet.
Die Sendung ist im Podcast hier gebührenfrei verfügbar.
Der moderne Sozialtypus des „deutschen Richters“ hat sich in der Umbruchszeit um 1800 herausgebildet. Diese Entwicklung ist eng gebunden an die Entstehung des Berufsbeamtentums und der Idee des „Rechtsstaats“. Aber geradlinig war diese Entwicklung nicht. Der Richterberuf hat mancherlei Wandlungen im Gefolge gesellschaftlicher Veränderungen erfahren. Den Tiefpunkt stellen die „furchtbaren Juristen“ des Nationalsozialismus dar. Aber auch in der Folgezeit und bis in die Gegenwart hinein erscheint der Berufsstand nicht immer in den leuchtendsten Farben und steht im Zuge der europäischen und globaler Rechtsentwicklungen aktuell wieder vor neuen Herausforderungen.