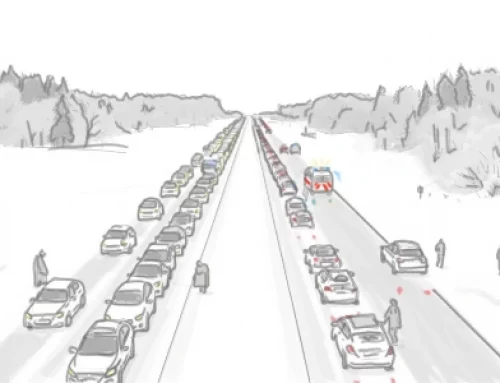Die Zeitenwende in der Diplomatie
Am 28. Februar 2025 trafen der gerade ins Amt gekommene US-Präsident und der kommissarische ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Oval Office des Weißen Hauses zu einem diplomatischen Gespräch zusammen. Die rund 40-minütige Konversation endete ziemlich undiplomatisch: Vor laufenden Kameras und unter Teilnahme der Weltöffentlichkeit gerieten die beiden Präsidenten, unter tätiger Mithilfe des US-amerikanischen Vizepräsidenten, in einen offenen Streit. Unverblümt wurde dem ukrainischen Gast die Tür gewiesen. Ihm wurde beschieden, er könne wiederkommen, wenn er sich eines Besseren besonnen habe. Erwünscht sei auf jeden Fall ein bescheideneres Auftreten und die Einsicht in die realen weltpolitischen Machtverhältnisse. Je nach politischer Couleur schrieben die Kommentatoren die Schuld an dem Eklat dem einen oder dem anderen der Beteiligten zu.
Der ukrainische Gast hätte in der Autobiographie des amerikanischen Vizepräsidenten nachlesen können, dass „Kampfstiefel und Khakihose keine geeignete Kleidung für ein Vorstellungsgespräch sind“ – und um das Vorstellungsgespräch eines Bittstellers handelte es sich de facto bei diesem Besuch im Weißen Haus. Aber der ukrainische Präsident trat im eleganten paramilitärischen Räuberzivil auf, was sein Gegenüber aufmerksam vermerkte und leicht spöttisch kommentierte. Im kriegslüsternen Europa kommt diese Kriegsgarderobe gut an, im Oval Office offensichtlich nicht, auch wenn die Designerin Elvira Gasanova im Nachgang erläuterte, dass sie die Präsidentenkleidung speziell für diesen Auftritt als „ganz bewusstes und kraftvolles Statement“ entworfen habe. In der Wahl der passenden Kleidung, die traditionell zu den wichtigsten Aufgaben der diplomatischen Kunst gehört, hatten sich der Präsident und seine Design-Beraterin also gründlich vergriffen. Und bei den politischen Forderungen hätte sich der ukrainische Präsident zuvor Rat bei Carl von Clausewitz einholen können: „Niemals wird man sehen, daß ein Staat, der in der Sache eines anderen auftritt, diese so ernsthaft nimmt wie seine Eigene. Auch wenn Bündnispflichten bestehen, wird üblicherweise das Interesse des anderen nicht zum Interesse des eigenen.“ Trump weiß das, Selenskyj nicht.
Der Ukrainer war offensichtlich einer Täuschung erlegen. In der Europäischen Union und in Großbritannien wird er seit dem Beginn des Krieges mit verbalen Gunstbezeugungen und materiellen Militär‑ und Finanzhilfen überhäuft. Er wurde im Übermaß als Bollwerk des freien Westen gegen die Hegemonialansprüche eines totalitären russischen Staates gefeiert, so dass er am Ende wohl selbst geglaubt haben wird, dass es so sei. Daraus scheint ein moralischer Überlegenheitsanspruch erwachsen zu sein, der vom Gesprächspartner die Erfüllung beliebiger Forderungen als selbstverständlich erscheinen ließ. In Europa hat das auch gut funktioniert, aber unter der neuen US-Administration funktioniert es eben nicht mehr. Hier herrschen andere Gesetze.
Diese Probleme sind nicht neu. Sie begleiten die Weltgeschichte seit zweieinhalbtausend Jahren. Weder der eine noch der andere der Verhandlungspartner im Oval Office wird gewusst haben, dass ihr Streitgespräch ein berühmtes Vorbild hatte: den Melierdialog in Thukydides‘ „Geschichte des Peloponnesischen Krieges“. Thukydides berichtete von den Verhandlungen, welche die übermächtigen Angreifer aus Athen mit den unterlegenen Verteidigern der Insel Melos führten. Die Melier glaubten das Recht und die Moral auf ihrer Seite zu haben, aber die Athener hatten die Macht. Gewonnen haben die Mächtigen. Athen eroberte und verwüstete Melos. Die Lehre aus der Geschichte war die, dass in internationalen Beziehungen „Recht“ nur ein Argument zwischen gleichstarken Kontrahenten ist; ansonsten sei es dem Schwächeren geraten, sich mit diplomatischer Klugheit in die Verhältnisse zu fügen und das Beste daraus zu machen. Später wird man das „Realpolitik“ nennen. Diesen Begriff hat der Liberale August von Rochau 1853 in seinem Buch „Grundsätze der Realpolitik“ eingeführt, um seine politischen Freunde, die Vormärzliberalen, nach der gescheiterten Revolution 1848 vor utopischen Illusionen zu warnen.
Die Lehren Bismarcks: Der Diplomat als „ehrlicher Makler“
Man hätte es vorher wissen können. Der US-Präsident sucht eine andere Rolle als die des willigen Vollstreckers ukrainischer Forderungen. Er hat offensichtlich das Bild des „ehrlichen Maklers“ vor Augen. Diese Denkfigur hat Otto von Bismarck in die Geschichte der Diplomatie eingeführt. Er prägte diese Redewendung in seiner Reichstagsrede über die „Balkankrise“ im Februar 1878. Auch damals ging es schon um Russland, genauer: um den russisch-türkischen Krieg, der umfassende und konfliktreiche Machtverschiebungen auf dem Balkan mit sich gebracht hatte, welche auch die Interessen Österreichs berührten.
Innenpolitisch hatte Bismarck in diesem Jahrzehnt eine weniger glückliche Hand; er verzettelte sich in den „Sozialistengesetzen“ und dem „Kulturkampf“ gegen die katholische Kirche. Außenpolitisch jedoch war sein Ansehen so groß, dass er in den hoffnungslos verwickelten Querelen, in die sich die Großmächte verstrickt hatten, als Vermittler gerufen wurde. Bismarck lehnte ausdrücklich die Rolle eines Schiedsrichters ab. Er suchte „mehr die eines ehrlichen Maklers, der das Geschäft wirklich zustande bringen will“ – eine Formulierung, die im Reichstag „Heiterkeit“ hervorrief. Die Metapher des „Geschäfts“ erinnert an den Amtsinhaber im Weißen Haus. Der US-Präsident definiert, seiner Sozialisation entsprechend, die Interessen seines Landes wesentlich über dessen ökonomisches Wohlergehen. Das hat seine Vorteile, denn im Kosmos der Ökonomie lässt sich das meiste in Heller und Pfennig ausrechnen und als Gewinn oder Verlust ausweisen. Und der amerikanische Präsident würde sich wahrscheinlich auch in jener Charakteristik geschmeichelt wiedererkennen, die Bismarcks Legationssekretär aus der Petersburger Zeit von seinem Vorgesetzten gab: Er sei ein „Gewaltmensch“; ein Mensch, der „keine Rücksichten kennt.“
Dem auch im Reichstag laut werdenden Drängen, Deutschland möge sich, wegen des „germanischen Interesses“, das Deutschland und Österreich verbinde, unverbrüchlich an die Seite Österreichs stellen, erteilte Bismarck eine ironische Absage. Ihn interessierte kein mythisches „germanisches“, sondern ein benennbares deutsches Interesse. Ansonsten gab er die Empfehlung, sich aus fremdem Händeln herauszuhalten, an denen „Deutschland kein Interesse haben“ könne und die die „gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Musketiers“ nicht wert seien. 36 Jahre später, 1914, wurde genau dieser diplomatische Grundsatz in den Wind geschlagen gemacht, mit den bekannten Folgen.
Kräfte der Beharrung: Das „Auswärtige Amt“
Otto von Bismarck hat das „Auswärtige Amt“ 1870 begründet. Es ist heute das älteste und das größte unter den deutschen Bundesministerien. Es beschäftigt 1905 Beamte, hinzu kommen die Bediensteten in den 225 Auslandsvertretungen. Aufgrund seiner Aufgabe hat das Auswärtige Amt eine Sonderstellung im institutionellen Machtgefüge des Staates. Per definitionem ist es darauf angewiesen, nicht nur die Interessen des eigenen Landes zu vertreten, sondern auch die Interessen fremder Länder substanziell ins eigene Handlungskalkül mit einzubeziehen und sie in globalen Zusammenhängen auszutarieren. Das muss man können, und dafür gibt es Traditionen der Diplomatie, die Jahrhunderte zurückreichen, und weiterhin gibt es lange und bewährte Ausbildungswege für die Beamten im Auswärtigen Dienst. Sie müssen besondere Fähigkeiten, Fertigkeiten und nicht zuletzt auch Talente und Charaktereigenschaften haben, um ihren Dienst versehen zu können. Es war kein gutes Zeichen, dass die 2021 neu ernannte Kurzzeitaußenministerin gleich zu Beginn ihrer Amtszeit die Einstellungsanforderungen für den diplomatischen Dienst zurückschraubte und sowohl den Allgemeinbildungstest wie auch den psychologischen Test abschaffte.
Von allen Ministerien weist das Auswärtige Amt die stärksten Kontinuitäten auf, die über alle Regimewechsel und Zeitenwenden hinweg einen stabilen Kern der Arbeitsformen und des politischen Stils gewährleisten. Selbst im „Dritten Reich“ galt es als ein Fremdkörper in der staatlichen Machtmaschinerie, auch wenn eine Historikerkommission 2010 in einer fast 900-seitigen Ausarbeitung auf Geheiß des seinerzeitigen Außenministers etliche braune Flecken auf der blütenweißen Weste aufgezeigt hat. Andererseits schrumpfte die Bedeutung des Auswärtigen Amts im „Dritten Reich“, weil der Kanzler selbst die außenpolitischen Fäden in der Hand hielt und auch, weil es sich der Konkurrenz einer ganzen Reihe weiterer außenpolitisch ambitionierter Akteure ausgesetzt sah.
Denn an der NS-Außenpolitik beteiligte sich eine ganze Reihe von Nichtregierungsorganisationen: Rosenbergs außenpolitisches Amt der NSDAP, die Auslandsorganisation der NSDAP und die „Dienststelle Ribbentrop“. Später entwickelte auch Göring einen privaten außenpolitischen Ehrgeiz. Joachim von Ribbentrop wurde 1938 zum Außenminister des Deutschen Reiches ernannt. Irgendeine Qualifikation für sein Amt hatte er nicht. Er kam nicht vom Völkerrecht, sondern verdiente seinen Lebensunterhalt als Vertreter des Sektfabrikanten Henkell, in dessen Familie er eingeheiratet hatte. Seine Ernennung war ein überdeutlicher Hinweis darauf, dass sich das „Dritte Reich“ von den Kontinuitäten deutscher Außenpolitik, von den Kontinuitäten der europäischen Diplomatie überhaupt, verabschiedete.
1946 wurde Ribbentrop als Hauptkriegsverbrecher hingerichtet, und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert spielte die Bundesrepublik eine diplomatische Sonderrolle in der Weltpolitik. Nach zwei verlorenen Weltkriegen hatte Deutschland jeden weltpolitischen Kredit verspielt und entwickelte auch keine Großmachtambitionen. Der erste Außenminister Konrad Adenauer verfolgte unbeirrt sein Ziel der Westbindung; der Außenminister und spätere Bundeskanzler Willy Brandt suchte die Versöhnung mit dem Osten. Größeren weltpolitischen Ehrgeiz hatte man nicht; und in der wohlhabenden Bonner Republik gewöhnte man sich sehr erfolgreich daran, außenpolitische Ziele durch Geldzahlungen zu erreichen. Speziell in der 16-jährigen Ära des Außenministers Genscher sprach man von „Scheckbuchdiplomatie“, mit der man sich die Welt zum Freund machen konnte. In der erstarrten, durch das Gleichgewicht des Schreckens, friedliche Koexistenz und geduldige Entspannungspolitik gekennzeichneten Welt des Kalten Krieges reichte das aus. Auch nach der Wiedervereinigung und in der in der nach 1989 entstehenden multipolaren neuen Weltordnung verstand sich die deutsche Außenpolitik, von einigen militärischen Abenteuern abgesehen, bis an die Grenze zur Selbstaufgabe als eine „Zivilmacht“, die ihre politische, auf wirtschaftliche Stärke gegründete Kraft nur im Rahmen internationaler Organisationen entfaltete. Diese Politik war nicht sehr ehrgeizig, aber das ist eigentlich das Beste, was man über Außenpolitik sagen kann.
Abschied von Bismarck
Am 9. November 2022 ließ die im Jahr zuvor ernannte Außenministerin das Bismarck-Zimmer in ihrem Dienstgebäude umbenennen und das Porträt des ersten Reichskanzlers entfernen. Dieser Abschied von Bismarck bedeutete auch den Abschied von der diplomatischen Denkfigur des „ehrlichen Maklers“.
Die aus dem Völkerrecht stammende neue Außenministerin hat ehrgeizigere Vorstellungen von Außenpolitik: Deutschland müsse das Klima retten, die Menschenrechte durchsetzen, Frauen auf aller Welt zur Emanzipation verhelfen und in einer „regelbasierten Weltordnung“ verankert sein – einer „Weltordnung“, deren Regeln sie selbst und ihre politische Entourage nach eigenem Ermessen festlegten. Der Rest der Welt schert sich um diese Regeln wenig; und auch die Diplomaten im Auswärtigen Amt scheinen nicht so recht gewusst haben, was eigentlich gemeint war.
Deshalb hat die Ministerin, dem Vorbild ihrer Amtskollegen im Klimaschutz‑, Umwelt‑, Familien‑ und Entwicklungshilfeministerium folgend, eine Parallelstruktur geschaffen und hoheitliche Aufgaben des Ministeriums auf NGOs ausgelagert. Sofort nach der Inbesitznahme des Ministeriums wurde unter starker Überdehnung des Beamten- und des Staatsbürgerschaftsrechts eine global tätige NGO-Aktivistin als Staatssekretärin und „Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik“ eingestellt. Damit war die Rettung des Weltklimas vom Werderschen Markt in Berlin aus in die Wege geleitet.
Auch die Menschenrechte kamen nicht zu kurz: Im Oktober 2022 wurde ein „Aufnahmeprogramm der Bundesregierung“ aufgelegt. Damit sollen große Teile der afghanischen Bevölkerung nach Deutschland transferiert werden, was offensichtlich ohne irgendeine Beeinträchtigung durch die afghanische Taliban-Regierung möglich ist. Seitdem wurden 26 000 Afghanen nach Deutschland verbracht und künftig sollen jeden Monat weitere 1000 folgen.
Für die Abwicklung dieses Programms vor Ort ist das Auswärtige Amt zuständig. Es hat diese Aufgabe aber an „Institutionen der Zivilgesellschaft“ und einen zivilen „Dienstleister der Bundesregierung“ weitergereicht hat, die wiederum von einer ebenfalls zivilgesellschaftlichen „Koordinierungsstelle der Zivilgesellschaft“ kontrolliert und koordiniert werden. Die eigentlich zuständigen Behörden haben nur noch die Aufgabe, jede „alternative Glaubhaftmachung“ – auch offenkundige Lügen über die einreiseermächtigten Personen – mit ihrem Dienstsiegel zu bestätigen. Einen Überblick, über das, was hier geschieht, hat niemand mehr, am wenigsten die deutschen Behörden.
Die Ministerin glaubt wahrscheinlich tatsächlich, dass sie damit den Menschrechten in Afghanistan zum Durchbruch verholfen haben. Aber es ist unverkennbar, dass diese Organisationen unter den Augen der Ministerin Asylpolitik auf eigene Rechnung machen. Die Auswahl der einreiseberechtigen Afghanen erfolgt durch „meldeberechtigte Stellen“, die von der Bundesregierung zertifiziert werden, aber anonym bleiben sollen. Der missionarische Bekenntniseifer – vielleicht ist es auch nur Eitelkeit – der Akteure bringt manchmal doch Licht ins Dunkel. Einer von ihnen, der Gründer, Vorsitzende und Sprecher des „Verein Mission Lifeline“, sieht in dem Aufnahmeprogramm einen Beitrag zur „Enthomogenisierung“ der deutschen Gesellschaft und versicherte den Deutschen ganz undiplomatisch: „Bald ist Schluss mit dem lustigen Leben als Weißbrot.“
Innenpolitisch ist die Regierung in der erfreulich kurzen Amtszeit der Außenministerin diesem Ziel einer „Enthomogenisierung“ zweifellos näher gekommen, das lässt sich am Straßenbild deutscher Städte ablesen. Außenpolitisch hingegen hat Deutschland jede Relevanz verloren.
***
Am Sonntag, 30. März 2025, wurde im „Kontrafunk“-Internetradio in der Reihe „Audimax – das Kontrafunkkolleg“ der Hörfunkvortrag
Utopien. Die Suche nach dem besseren Leben
von Peter J. Brenner gesendet.
Die Sendung ist im Podcast hier gebührenfrei verfügbar.
Vorstellungen vom besseren Leben finden sich bereits in den ältesten Urkunden des Menschengeschlechts. Mit dem Beginn der Neuzeit werden die Mythen vom „Goldenen Zeitalter“ und vom „Paradies“ abgelöst durch Gesellschaftsutopien. Daneben gibt es seit Rousseau die folgenreiche Utopie vom natürlichen Leben, und seit dem 19. Jahrhundert beherrschen sozialistische Vorstellungen das utopische Denken. Im 21. Jahrhundert verblassen die Utopien, aber ihre Restbestände bleiben weiterhin politisch wirksam.