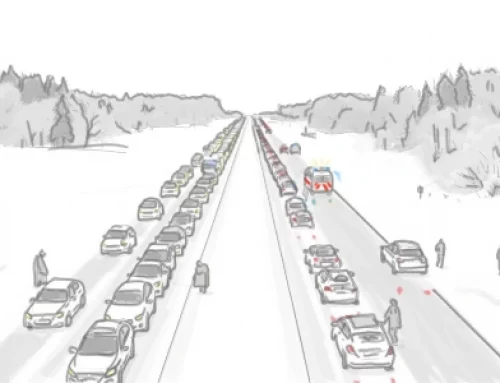Die Kapitulation und die Last des Gedenkens
2025 jährte sich zum 80. Mal der Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Bis heute weiß man in der Bundesrepublik nicht so recht, ob es an diesem Tag etwas zu feiern gibt. In der deutschen Schulbuchgeschichtsschreibung wird dieser 8. Mai als Ende des Zweiten Weltkrieges verbucht. Das war er jedoch keineswegs. Zu Ende ging der Zweite Weltkrieg erst mit der bedingungslosen Kapitulation Japans am 2. September 1945. Ihr vorangegangen war ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung: der Abwurf der ersten und bislang einzigen Atombomben auf die Städte Hiroshima und Nagasaki. Aber auch das Kriegsende in Europa ist nicht ganz so eindeutig. Die Kapitulationsurkunde wurde von Generalfeldmarschall Keitel, Generaladmiral von Friedeburg und Generaloberst Stumpff in Berlin-Karlshorst, dem Hauptquartier der 5. Stoßarmee der Roten Armee, unterzeichnet. Die Urkunde trägt das Datum des 8. Mai 1945; unterzeichnet wurde sie aber nach Mitternacht, in der ersten Stunde des 9. Mai – damals hatte man wohl andere Sorgen als die Eindeutigkeitsbedürfnisse der nachgeborenen Historiker. Das führte jedenfalls dazu, dass in der Sowjetunion und in Russland der Tag des Sieges über den Faschismus am 9. Mai gefeiert wurde und wird.
Das Ende eines Krieges ist immer ein Anlass zum Feiern. Es hat jedoch sehr lange gedauert, bis der 8. Mai einen Platz in der bundesdeutschen Liturgie der „Vergangenheitsbewältigung“ gefunden hat. Diese „Vergangenheitsbewältigung“, die seit den 1990er Jahren etwas vornehmer „Erinnerungskultur“ heißt, war und ist das Zentrum bundesrepublikanischer Selbstverständigungsdiskussionen. Auf ihre jüngere Vergangenheit sind die Deutschen nicht besonders stolz. Dafür gibt es Gründe. Umso stolzer sind sie hingegen auf ihre Bewältigung dieser Vergangenheit. Wenn man schon nicht auf seine jüngere Geschichte identitätsstiftend zurückgreifen kann, dann doch wenigstens auf den Umgang mit dieser Geschichte. Die Menschheitsverbrechen der Vernichtung der europäischen Juden und der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges konnten die Funktion einer neuen, nun negativen, Identitätsstiftung übernehmen. Das war ein historisches Novum: Denn diesmal waren es nicht die eigenen Opfer, derer man gedachte, sondern die Opfer der anderen.
Skeptische Beobachter im In- und Ausland haben schon früh darauf hingewiesen, dass es ein welthistorisch einzigartiges Experiment sei, nationale Identität auf einen negativen Gründungsmythos aufbauen zu wollen. Der politisch einschlägig unverdächtige Historiker Hans-Ulrich Wehler erklärte anlässlich des 8. Mai 2005 lapidar: „Aber die Größe eines Verbrechens adelt es nicht zum Identitätsstifter.“ In Deutschland hat diese in der jüngeren Geschichte der Nationalstaaten singuläre Selbstauslöschung nationaler Identität eine Leerstelle hinterlassen und das Bedürfnis nach „Identitätskompensationen“ hervorgerufen. Parallel zur Erinnerung an die jüngere deutsche Unheilsgeschichte hat es deshalb auch einige, wenn auch recht zaghafte Versuche zur positiven Identitätsstiftung durch den Rückgriff auf historische Ereignisse gegeben.
Gedenktage dienen der Absicherung kollektiver Identität, und das gilt im besonderen Maße für Nationalfeiertage. Aber nicht jede Nation hat das Glück, sich auf ein weitgehend unumstrittenes und einigermaßen sicher identifizierbares Ereignis wie die Unabhängigkeitserklärung von 1776 oder den Sturm auf die Bastille von 1789 berufen zu können. In der Regel ist es recht mühsam, einen konsensfähigen Anlass für den Nationalfeiertag zu finden – mühsam, aber oft unverzichtbar. Denn nicht selten, und besonders in Deutschland, dienen Nationalfeiertage dazu, die Unsicherheit gegenüber der eigenen nationalen Identität zu verbergen.
Befreier und Befreite
Die Erinnerungsbewirtschaftung per nationaler Feiertage ist ein schwieriges Geschäft, in dem der 8. Mai ein besonders sperriges Handelsgut darstellt. Lange Jahrzehnte wurde das Datum aus dem Gedächtnis der Bundesrepublik getilgt, indem man es kurzerhand zur „Stunde Null“ erklärte. Die Vorstellung, man solle eine Niederlage feiern, war den überlebenden Zeitgenossen des „Dritten Reichs“ merkwürdig vorgekommen.
In seiner Abschlussrede vor dem Parlamentarischen Rat fand der spätere Bundespräsident Heuß die ziemlich realistische Formel, am 8. Mai sei Deutschland „erlöst und vernichtet in einem gewesen“, etwas ausführlicher hatte das zwei Jahre zuvor Thomas Mann im „Dr. Faustus“ ausgefaltet. Zum fälligen ersten Jubiläum des zehnten Jahrestags 1955 einigten sich Bundespräsident und Bundeskanzler, diesen Tag möglichst geräuschlos hinter sich zu bringen. Es hat dreißig weitere Jahre gedauert, bis man sich dem Thema annäherte.
1985 hat der Bundespräsident Richard von Weizsäcker den 8. Mai genutzt, um der Bundesrepublik ein neues erinnerungspolitisches Fundament zu geben. Der damals vielumstrittene, heute dogmatisch gewordene Schlüsselsatz heißt: „Der 8. Mai war der Tag der Befreiung“. Man hat lange und mit guten Gründen diskutiert darüber, ob es wirklich ein Tag der Befreiung war, wer hier von wem befreit wurde und ob der Befreiung nicht zumindest in einem Teil Deutschland eine neue Unterdrückung auf dem Fuß folgte. Das sind Fragen für Historiker, an denen sich Erinnerungspolitiker nicht weiter abarbeiten müsse.
Für sie zählt die Gegenwart. Die Formel von der „Befreiung“ hatte den Vorteil, dass Sieger und Besiegte nicht mehr so richtig zu unterscheiden waren. Dem Sieg der einen stand nicht etwa, wie sonst in der Geschichte üblich, die Niederlage der anderen gegenüber, sondern ihre „Befreiung“. Bei den Alliierten sah man das übrigens anders: Für sie war es der Tag der bedingungslosen Kapitulation, und bis heute tut man sich bei den alliierten Gedächtnisfeiern schwer, die Anwesenheit hochrangiger deutscher Politiker zu dulden. Aber jedenfalls war es ein rhetorischer Bravourakt des Bundespräsidenten, sich auf diese Weise in die Siegergeschichte hineinzumogeln.
Im Jubel der bundesdeutschen Feuilleton-Intellektuellen, mit dem dieser Satz von der „Befreiung“ aufgenommen wurde, ist der einfache Befund untergegangen dass der Bundespräsident jetzt dort angekommen war, wo die DDR immer schon war. Denn im zweiten deutschen Staat ist man die Sache wesentlich geradliniger angegangen: Hier war der 8. Mai immer schon der Tag der Befreiung, genauer: der „Befreiung vom Faschismus“. Befreit worden war man vom großen sowjetischen Bruder, dessen Truppen man deshalb noch bis 1994 Gastrecht auf ostdeutschem Boden zugestehen musste. Der 8. Mai war in der DDR bis 1967 gesetzlicher Feiertag. Bei der Einführung der Fünf-Tage-Woche wurde dieser Feiertag zusammen mit etlichen anderen arbeitsfreien Tagen abgeschafft und einmalig, zum 40. Jahrestag, wieder eingeführt. In Berlin, wo man dank des Länderfinanzausgleichs aus dem Vollen schöpfen kann, erinnerte man sich gerne daran und verordnete, wie schon 2020, den 8. Mai 2025 als einmaligen Feiertag. In der Sowjetunion und im postsowjetischen Russland wurde und wird der 9. Mai pompös mit Militärparaden gefeiert; und auch bei den anderen alliierten Siegermächten gibt es, im kleineren Maßstab, Erinnerungsveranstaltungen. In rund zwanzig Staaten, bis hin nach Zentralasien, nach Tadschikistan und Usbekistan, wird der 8. oder 9. Mai als Tag des Sieges über den Faschismus, oft auch als Nationalfeiertag, gefeiert. Dass am 9. Mai seit 1950 auch der „Europatag“ als ideeller Gründungstag der Europäischen Union gefeiert wird, dürfte hingegen kaum jemandem bewusst sein.
Die Gegenwart der Vergangenheit
Gedenktage machen keine Aussage über die Vergangenheit, sondern über die Gegenwart, und die Gegenwart legt sich die Geschichte gerne so zurecht, wie sie sie gerade braucht – nicht selten und im wieder zunehmenden Maße unter tätiger Beihilfe der Geschichtswissenschaft. Gedenkfeiern sind ein hohles Gefäß, in das man, je nach tagespolitischer Opportunität, mal diesen, mal jenen Inhalt einfüllen kann. Mit der Geschichtswissenschaft hat das Gedenken meist wenig zu tun, und mit der realen Geschichte noch weniger, aber in der Tagespolitik kann es höchste Brisanz entfalten. Die Frage, wer sich mit wem wo trifft um was genau zu feiern, kann eine herausragende diplomatische Bedeutung erhalten und mancherlei Verwerfungen hervorrufen, wenn sie falsch beantwortet wird.
Einen schnörkellosen Umgang mit der Erinnerung an das Kriegsende pflegt man seit je in Moskau. Auch an diesem 80. Jahrestag fand, mitten im Krieg mit einem Nachbarland, auf dem Roten Platz die seit Sowjetzeiten übliche Militärparade statt. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Genau hinschauen muss man jedoch jedes Jahr aufs Neue. In diesem Jahr stand neben dem russischen Staatspräsidenten der chinesische Ehrengast Xi Jingping, neben allerlei Kollegen aus den postsowjetischen Nachbarstaaten. Vertreter aus dem Westen fehlten aus naheliegenden Gründen.
Auch der deutsche Bundespräsident nutzte 2025 seine Rede am 8. Mai zur Verbreitung einer tagespolitischen Botschaft. Diese Rede schien diesmal mehr nach außen als, wie sonst üblich, nach innen gerichtet zu sein. Auf der Website des Bundespräsidialamtes ist sie in acht Sprachen übersetzt; ein besonderes Leseerlebnis ist ihre Lektüre in „Leichter Sprache“, wobei der Unterschied zum Original nicht gar zu groß ist. Dass sie auf Russisch und Ukrainisch verfügbar ist, liegt nahe, denn ihre Adressaten sind nicht zuletzt die Präsidenten dieser beiden Staaten – wobei der russische Präsident sie auch auf Deutsch hätte lesen können, wenn es ihn interessieren sollte. Der Bundespräsident nutzte die Erinnerung an den „Tag der Befreiung“ dafür, auch die Befreiung der Ukraine mit bundesdeutscher Unterstützung anzukündigen.
Ob man eine präsidiale Rede zum „Tag der Befreiung“ nutzen sollte, der Ukraine Unterstützung gegen den russischen Angreifer zuzusichern, ist eine Frage des diplomatischen Geschicks und der politischen Klugheit. Das Datum legte es eigentlich nahe, zunächst einmal mit den eigenen Angelegenheiten ins Reine zu kommen. Dass aber die Redenschreiber des Präsidenten den „Angriffskrieg Russlands“ und den „Wertebruch Amerikas“ in einem Halbsatz zusammenpacken, ist Ausdruck einer offensichtlich unausrottbaren deutschen Großmannssucht, die dem alten Landsknechtsmotto aus dem 15. Jahrhundert folgt: „Viel Feind, viel Ehr‘“.
Migranten – „Kinder des 8. Mai“?
Seiner obligatorisch gewordenen Rede zum 8. Mai 2025 hat der diesmal zuständige Bundespräsident die Überschrift gegeben: „Wir sind alle Kinder des 8. Mai“. Das sei ein Zitat des Philosophen Jürgen Habermas, von dem es heißt, er stehe in einem gelegentlichen Austausch mit dem Bundespräsidenten. In den wohlmeinenden Medien wurde speziell dieser Bezug des Präsidenten auf den Philosophen viel gelobt. Aber niemand hat herausgefunden oder auch nur gefragt, von wann dieses Zitat stammt. Man darf annehmen, dass es im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung formuliert wurde. Jürgen Habermas hat zum 50. Jahrestag der Kapitulation in der Frankfurter Paulskirche einen Festvortrag mit dem Titel: „1989 im Schatten von 1945“ gehalten. Hier hatte die Formel ihren Sinn: Ost- und Westdeutsche waren tatsächlich gleichermaßen „Kinder des 8. Mai 1945“. Danach hat sich aber einiges getan.
Der vierte Nachfolger des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker hat ebenfalls einen ikonischen Satz zur Charakterisierung der Lage in Deutschland gefunden: „Der Islam gehört zu Deutschland“, postulierte er nicht am 8. Mai, sondern aus einem ähnlichen Anlass, am 3. Oktober 2010, in seiner Rede zum 20. Jahrestag der deutschen Einheit. Damals stieß der Satz noch auf gelegentlichen Widerspruch auch in den eigenen parteipolitischen Reihen. Aber die exekutiv zuständige Bundeskanzlerin ließ den Satz von ihrem Regierungssprecher als regierungsamtliche Version bundesdeutscher Identität weiter verbreiten. Fünf Jahre später, am 4. September 2015, sorgte sie dafür, dass aus einer politischen Wunschvorstellung gesellschaftliche Wirklichkeit wurde.
Wer wiederum zehn Jahre später ganz wohlgemut verkündet, wir alle seien „Kinder des 8. Mai“, dem muss wohl etwas entgangen sein. Rund 28 Prozent der deutschen Wohnbevölkerung sind definitiv nicht mehr „Kinder des 8. Mai“. Denn diese 28 Prozent sind nach 1945 zugewandert oder sie sind Nachkommen von Zuwanderern, inzwischen schon in der vierten Generation. Es hat also durchaus seinen Sinn, wenn die Rede des Bundespräsidenten auch in türkischer und arabischer Sprache verbreitet wird. Man hätte auch Übersetzungen in Kurdisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch, Paschti, Dari, Tigrinya, Farsi, Somali und Französisch hinzufügen können, denn das sind die Gebrauchssprachen größer werdender Teile der deutschen Bevölkerung.
1986, im unmittelbaren Gefolge der Weizsäcker-Rede, entbrannte in der Bundesrepublik der „Historikerstreit“, der in dem halb konsensuellen, halb staatlich verordneten Ergebnis mündete, dass die Vernichtung der europäischen Juden ein unvergleichliches, ein singuläres Ereignis gewesen sei. An diese Grundsäule deutscher Identität erinnerte der Bundespräsident in seiner Rede: „Für Antisemitismus darf es in unserer Gesellschaft keinen Raum geben.“
Der Bundespräsident hielt seine Rede in der deutschen Hauptstadt, auf deren Straßen seit Monaten ein antisemitischer Mob freien Auslauf hat, der die Auslöschung Israels fordert. Aber diesen Mob hat der Präsident nicht gemeint mit seiner Mahnung vor dem neuen Antisemitismus. Und er meint offenkundig auch nicht jene akademischen Büchsenspanner an den Universitäten und in den Feuilletons, die eine phantasierte Kolonialgeschichte gegen Auschwitz ausspielen und die Vernichtung der europäischen Juden als eine Bagatelle in der Menschheitsgeschichte ausmachen, welche die Weißen unter sich ausmachen sollten.
Die Erinnerungsrituale der alten Bundesrepublik haben ihren Sitz im Leben verloren. Sie sind Teil einer routinierten Jubiläumsindustrie geworden, die sich immer weiter von der gesellschaftlichen Wirklichkeit dieses Landes entfernt und die immer stärker dazu beiträgt, die realen Probleme dieses Landes zu verschleiern.
***
Am Sonntag, 25. Mai 2025, wurde im Kontrafunk“-Internetradio in der Reihe „Audimax – das Kontrafunkkolleg“ der Hörfunkvortrag
Grenzüberschreitungen – die Deutschen und die Migration
von Peter J. Brenner gesendet.
Die Sendung ist im Podcast hier gebührenfrei verfügbar
Die deutsche Geschichte der Neuzeit kennt Migration in allen denkbaren Formen: als Zuwanderung und Auswanderung, Deportation und Vertreibung, Wirtschaftsmigration und politische Fluchtmigration. Jede Migration bedeutet eine Herausforderung für die ethnisch-kulturelle Identität sowohl des Aufnahmelandes wie der Migranten selbst, und jede Migration wirft Probleme auf, die in der deutschen Geschichte auf unterschiedliche Weise bewältigt wurden. Mit dem 4. September 2015 haben sie eine historisch neue Dimension angenommen.