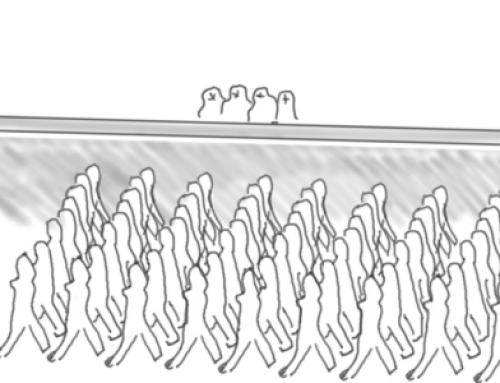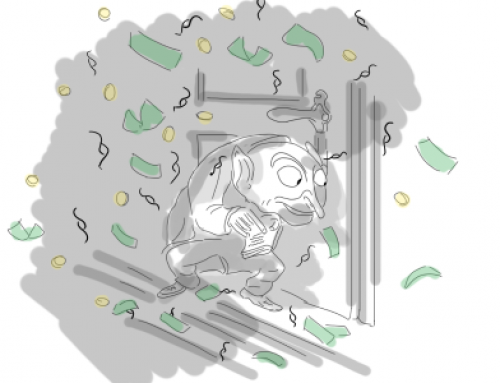„Pride Month“ in der Allianz Arena
Der Regenbogen ist ein ästhetisch reizvolles Naturphänomen. Dass er in den Strudel identitätspolitischer Auseinandersetzungen gezerrt wird, hat er nicht verdient. Genau das ist aber passiert. Aus irgendwelchen Gründen wurde der Monat Juni, eigentlich der Monat der Sonnenwende oder der „Rosenmonat“, von diversen amerikanischen Präsidenten zum „Pride Month“ erklärt. Der „Pride Month“ ist also eine aus den USA importierte und dort schon seit langem etablierte Feierlichkeit, in der die westliche Öffentlichkeit auf Rechte von LGBTIQ+-Personen aufmerksam gemacht werden soll. LGBTIQ+ steht für Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender, Intersex, Queers + beliebig viele weitere Varianten sexueller Identität. Das Symbol dieser Bewegung ist der Regenbogen, der „Vielfalt“ oder „Diversity“ ausdrückensoll. Dagegen kann man nichts sagen. Wer genauer hinschaut und sich die Phrase „Pride Month“ ins Deutsche übersetzt, wird sich allenfalls fragen, welchen Grund es eigentlich geben soll, auf eine sexuelle Orientierung „stolz“ zu sein, und das auch noch einen ganzen Monat lang. Sexuelle Orientierungen mögen so oder so sein, aber sie sind jedenfalls eine private Angelegenheit und ein Verdienst, auf das man stolz sein könnte, sind sie wohl eher nicht.
An Menschen, denen dieses internationale Politkauderwelsch noch unvertraut ist – das werden die meisten sein – würde der „Pride Month“ ohnehin spurlos vorübergehen, wenn nicht unter erheblichem Einsatz auch öffentlicher Mittel die Aufmerksamkeit für ihn erzwungen würde. Unter dem Gesichtspunkt der Aufmerksamkeitsbewirtschaftung war es sicher ein gelungener Coup, dass ein Fußballspiel der Europameisterschaft am 23. Juni 2021 in einem in den Regenbogenfarben illuminierten Münchener Stadion stattfinden sollte. Noch gelungener war es, dass die UEFA als Ausrichter der Europameisterschaft sich diesem Vorschlag verweigerte und damit hellauflodernde Empörung in der westlichen Fußball- und Medienwelt hervorrief. Deutschlandintern ist man nämlich schon weiter: Im März 2019 bot der Deutsche Fußballbund beim Länderspiel der Männer in Wolfsburg gegen Serbien seinen Zuschauern ein „genderneutrales Stadionerlebnis“ an. Im Angebot waren Unisex-Toiletten und die Stadionbesucher konnten sich zudem selbst aussuchen, ob sie sich von männlichen oder weiblichen – weitere Identitäten waren nicht vorgesehen – Ordnern untersuchen lassen. Genützt hat es nichts, heraus kam ein mageres 1:1 der „Mannschaft“ gegen Serbien.
Diese Kampagnen haben schon ihren Grund, denn die Diskriminierung – oder zumindest die Diskussion darüber – ist allgegenwärtig auf dem grünen Kunstrasen deutscher Fußballstadien. Am 10. April 2021 berichtete das Hamburger Unterhaltungsmagazin „Der Spiegel“ von einer Studie der Berliner Humboldt Universität über Rassismus im deutschen Fußball, speziell im Fußballtor. Die Studie hat festgestellt, dass nur drei Prozent der Torhüter in der Ersten und Zweiten Fußballbundesliga „Persons of Color“ seien. Die Schaltstellen im Mittelfeld hingegen seien fast ausschließlich, wenn auch nicht mit alten, so doch immerhin weißen Männern besetzt. Bei der Besetzung dieser Positionen würden die Akteure also, so schlossen die Autoren, auf ihre „körperlichen Merkmale reduziert“, was ansonsten im Fußball bekanntlich nicht üblich ist. Inspiriert wurde die Studie offensichtlich durch die Beschwerde eines ehemaligen Torhüters des Zweitligafußballvereins SpVgg Greuther Fürth, der sich darüber beklagt hat, dass er nie ein Angebot aus der Ersten Liga bekommen habe, was nur mit seiner Hautfarbe zusammenhängen könne.
Die Ungarn und der „pädagogische Takt“
Am Tag der verweigerten Regenbogenfarben musste die deutsche „Mannschaft“ ausgerechnet gegen die ungarische Nationalmannschaft spielen – und erreichte dabei, nebenbei gesagt, ein mühsames Unentschieden gegen den 37. der FIFA-Weltrangliste, was gerade noch zum Aufrücken in die nächste Runde ausreichte. Ungarn war nun der eigentliche Stein des Anstoßes. Denn in dem EU-Land Ungarn hatte das Parlament – und nicht etwa der Präsident, wie man nach der Lektüre deutscher Presseberichte glauben könnte – mit sehr großer Mehrheit gerade ein Gesetz zu diesem Thema beschlossen; ein Gesetz, gegen das auch die Opposition nicht stimmen wollte – sie blieb der Abstimmung fern –, weil es große Popularität in der ungarischen Bevölkerung genoss. Auch außerhalb der Fußballstadien schlug das Gesetz hohe Wellen, deutsche Politiker äußerten ihren Abscheu, und die EU-Kommissionspräsidentin, auch sie eine Deutsche, kündigte ein Vertragsverletzungsverfahren an. Denn es ging „um unsere Werte“, die „westlichen“, die „europäischen Werte“, die man hier mit Füßen getreten sah, weil das ungarische Gesetz Ausdruck von „Homophobie“ sei.
Das eigentliche Anliegen des Gesetzes war die Zurückdrängung der Sexualisierung des schulischen Unterrichts und der Öffentlichkeit im Interesse des Kinder- und Jugendschutzes. Man muss nicht erzkatholisch sein – und vielleicht gerade das nicht –, um die Sexualisierung des Unterrichts an Schulen bedenklich zu finden. Dazu reicht ein Blick in die Geschichte der deutschen Reformpädagogik mit ihren periodisch wiederkehrenden sexuellen Exzessen. Sie zeigen, wohin es führt, wenn die Institution Schule alle Grenzen überschreitet. Die ältere Erziehungswissenschaft kannte noch den Begriff des „pädagogischen Taktes“, den einst Johann Friedrich Herbart in die Diskussion eingeführt hatte. Dieser „Takt“, so wissen es verstaubte pädagogische Lexika zu definieren, ist eine „soziale Tugend“, die „aus Achtung vor der Würde des anderen dessen Recht auf Selbstbestimmung und auf Schonung der Intimsphäre respektiert“. Heute ist aus der „Achtung“ der „Respekt“ geworden, den beliebige Randgruppen für sich mit brachialer öffentlicher Aufmerksamkeitserzwingung erwirken wollen. Die Achtung und die Schonung anderer spielt dabei nur noch eine geringe Rolle.
Das ungarische Gesetz hat durchaus seine bedenklichen Seiten. Denn es beschränkt sich nicht auf die Schule, sondern bezieht die Darstellungen von Homosexualität in der Öffentlichkeit ein, ein dehnbarer Paragraph, wie man zu Recht festgestellt hat, der politisch motivierter Zensur Tür und Tor öffnet. Damit erweist sich der ungarische Gesetzgeber als gelehriger Schüler des deutschen. Wer das kritisiert, und man kann es mit guten Gründen kritisieren, sollte, wie immer in solchen Fällen, zunächst einen Blick auf das eigene Land werfen, in dem die Hass- und Hetze-Gesetzgebung und das „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ ungleich weitere Eingriffsrechte des Staates in die öffentliche Meinungsbildung ermöglichen.
Aber wie immer man zum ungarischen Gesetz steht: Geböte nicht der „Respekt“ – sagt man nicht so? – vor dem parlamentarischen Gesetzgeber eines EU-Landes es auch deutschen Journalisten und Politikern, sich kritisch und auf einem intellektuell angemessenen Niveau – soweit der Intellekt eben reicht – damit auseinanderzusetzen, statt hetzerische Kampagnen in Fußballstadien zu inszenieren?
Gerangel um Marktanteile
Was Fußballer politisch so treiben, muss man nicht besonders ernst nehmen. An die Reflexionsfähigkeit deutscher Spitzensportler darf man nicht allzu hohe Ansprüche stellen, und speziell im Fußball gilt man schon als Intellektueller, wenn man das Abitur an einem Sportgymnasium bestanden hat. Aber die durch die Fußballeuropameisterschaft ins Blickfeld öffentlicher Aufmerksamkeit gerückten Vorgänge sind Symptome sehr viel tiefer reichender gesellschaftlicher Verwerfungen. Diese Aktionen werden mit dem Anspruch inszeniert, einen Kampf gegen die Diskriminierung von Minderheiten zu führen. Aber will wirklich jemand behaupten, dass die Minderheiten, die sich hier zu Wort melden, oft nicht einmal selbst, sondern ungefragt vertreten durch paternalistische Fürsprecher, in Deutschland diskriminiert werden? Niemand, der bei Sinnen ist, wird behaupten können, dass die Bundesrepublik des Jahres 2021 eine homophobe oder rassistische Gesellschaft sei. Gewiss gibt es auch in Deutschland Homophobie und Rassismus. Wer sie sucht, wird am leichtesten in den islamisch geprägten Zuwanderermilieus fündig werden. Aber wer über den eindeutig islamistisch-homophob motivierten Mord vom Oktober 2020 in Dresden nicht sprechen will, soll über Homophobie im Fußballstadion schweigen.
Aber am Ende geht es ohnehin um etwas ganz anderes. Den politischen Gehalt dieser aktuellen Regenbogenaktionen in Fußballstadien und auf Markplätzen darf man nicht überschätzen. Sie sind Inszenierungen eines strategischen Kampagnenmanagements, mit dem die LGBTIQ+-, Gender-, BLM-, Greenpeace‑, FFF-Aktivisten versuchen, sich auf einem umkämpften Markt zu behaupten. Denn der Markt wird enger, und die öffentliche Aufmerksamkeit ebenso wie die an sie gekoppelte Spendenbereitschaft sind knappe Ressourcen.
Im Wesentlichen lassen sich in Deutschland vier Segmente auf dem zivilgesellschaftlichen Markt erkennen: Seit den frühen 1970er Jahren gut etabliert ist die Umweltschutzbewegung, die sich neuerdings nicht ohne innere Macht-und Beteiligungskämpfe zur Klimaschutzbewegung umformt. Hier stehen die alten weißen Männer der ersten und zweiten Aktivistengeneration – zu denen auch der 38-jährige Gleitschirmbruchpilot der Münchener Allianz Arena gehörte – gegen die FFF-Generation, die sich eher aus den Jungen, Schönen und Reichen rekrutiert. Daneben steht, dank umfangreicher staatlicher Alimentierung, der „Kampf gegen rechts“; neu in den Wettbewerb als Anbieter politischer Sinnangebote eingetreten ist die LGBTIQ+-Bewegung, die sich aus der Feminismus- und Gendersparte weiterentwickelt hat, und auch die Black-Lives-Matter-Aktivisten haben erstaunlich schnell einen Fuß in die Tür bekommen. Sie alle haben ihre eigene Symbolsprache, ihr Branding, das, nicht anders als im globalen kapitalistischen Unternehmenswettbewerb, eingesetzt wird, um Aufmerksamkeit zu erregen und Marktanteile zu erweitern. Dass es den Erfindern des „Regenbogens“ gelungen ist, die öffentliche Bühne des Weltfußballs als Trittbrettfahrer zu besetzen, ist ein gelungener unternehmerischer Coup, der durchaus Anerkennung, wenn nicht gar „Respekt“ verdient. Diese Vermischung von Sport, Geschäft und Politik ist gewiss eine zukunftsweisende Strategie, die sich im ersten Ansatz schon einmal bewährt hat. Über Wochen hinweg flattert die Fahne des „Regenbogens“ dem Fußball voran und beherrscht die Diskussionen. Dass die UEFA das nicht gerne sieht und es unterbindet, soweit ihr Arm reicht, kann man verstehen. Denn mit den Regenbogenfahnen drängt die moralisch unterfütterte politische Aussage in den Vordergrund und droht das Fußballgeschäft, das ebenfalls existenziell auf öffentliche Aufmerksamkeit angewiesen ist, zu stören.
Die Ideologisierung des öffentlichen Raums
Es ist lange her, dass in Deutschland der öffentliche Raum in dieser Weise mit politischer Symbolik durchsetzt wurde. Zum letzten Mal war das der Fall am 7. Oktober 1989 im östlichen Teil Deutschlands. Die DDR feierte ihren 40. und letzten Geburtstag mit einem endlosen Fahnen- und Flaggenmeer, das den öffentlichen Raum belagerte: die Staatsflagge mit Hammer und Zirkel, die roten Fahnen, die Parteifahnen der SED mit dem Verbrüderungshandschlag, die blauen Fahnen der FDJ dominierten die öffentliche Wahrnehmung. Wie es ausgegangen ist, weiß man.
Diese symbolische Überfrachtung des öffentlichen Raums ist eine Eigenart von totalitären Systemen. Die Überwältigungspropaganda solcher Symbolkampagnen, ob es nun SED-Fahnen oder Regenbogenflaggen sind, lähmt die Sinne und schnürt das Denken ein. Die Demokratie, die antike genauso wie die moderne, hat ihre raison d’être hingegen in der freien politischen Rede und Gegenrede, nicht im wechselseitigen Vorzeigen von Symbolen.
Die Herrschaft der Symbole ist eine Regression; ein Rückfall in vordemokratische und vormoderne politische Praktiken. Nirgends zeigt sich das so deutlich wie im Niederknien von Sportlern, um der Black-Lives-Matter-Bewegung ihre Reverenz zu erweisen. Das Niederknien ist ein religiöses Ritual und eine Unterwerfungsgeste aus feudaler Zeit, die in einer modernen Demokratie nichts zu suchen hat. Bei der Fußballeuropameisterschaft erreichte diese Praxis pandemieartige Ausmaße. Auch die deutsche „Mannschaft“ folgte vor ihrem letzten Spiel diesem Ritual, übrigens zum hörbaren Unmut der englischen Zuschauer. Deshalb wurde das Ereignis in den Rückblicken der Leitmedien auch auffällig stiefmütterlich behandelt.
Die Macht der Symbole und die Ohnmacht der Vernunft
Die Symbole haben sich in jüngster Zeit rasant vermehrt. Am erfolgreichsten waren der Genderstern und die ihm verwandten Grapheme. Aber auch das Kopftuch von Musliminnen, der Regenbogen der LGBTIQ+-Bewegung, die Kniebeuge der BLM-Sportler, die Maske des Corona-Regimes sind stumme Bekenntnisse zu politischen Überzeugungen, die sich jeder Diskussion entziehen. Über Symbole kann man nicht diskutieren. Sie lassen nur ein Ja oder Nein zu. Im Gebrauch der Symbole zeigt sich die Bereitschaft zur Unterwerfung; in ihrer Missachtung die selten gewordene Dissidenz. Diese Symbole treten an die Stelle von Argumenten und Sachwissen.
Wo soll das alles hinführen? Muss man damit rechnen, dass diese Pädagogik der Überwältigung in die Schulen eindringt und dass in deutschen Grundschulen künftig statt des Morgenkreises die deutschen Schüler vor ihren ausländischen Mitschülern niederknien werden? Und vielleicht wird die nächste Schülergeneration glauben, dass der Regenbogen kein physikalisches Phänomen ist, sondern ein politisches Symbol, mit dem die Natur sich zur sexuellen Vielfalt bekennt.
Man kann das 2:0 verlorene Spiel der „Mannschaft“ gegen die englische Nationalmannschaft vom 29. Juni 2021 auch als lehrreiche Parabel lesen: Moral schießt keine Tore und auf Knien gewinnt man keine Spiele. Allgemein gesprochen: Wer sich nur mit selbst herbeigeredeten Problemen beschäftigt, wird an der Wirklichkeit scheitern.
1930 schloss Karl Kraus eine kleine Glosse – sie trug kurioserweise den Titel „Wegen der Maske“ – mit der zum geflügelten Wort gewordenen Bemerkung: „Meine Sorgen möcht ich haben“. Ein paar Jahre später wusste man in Deutschland und Österreich, wohin es führt, wenn man sich allzu sorglos den falschen Sorgen widmet und die wirklichen Probleme aus den Augen verliert.
***
Beachten Sie auch die gerade eingestellte Besprechung des Buchs von Florian Meinel: „Vertrauensfrage“ im „Lesepult“.