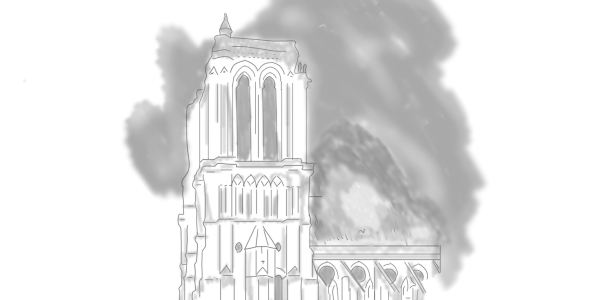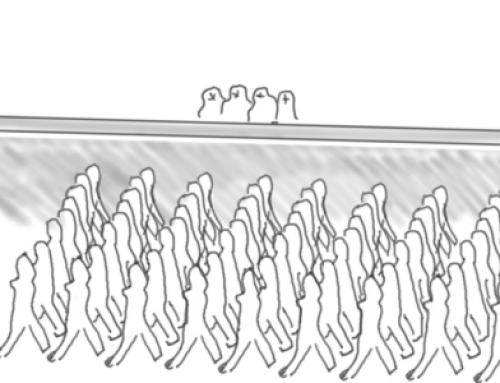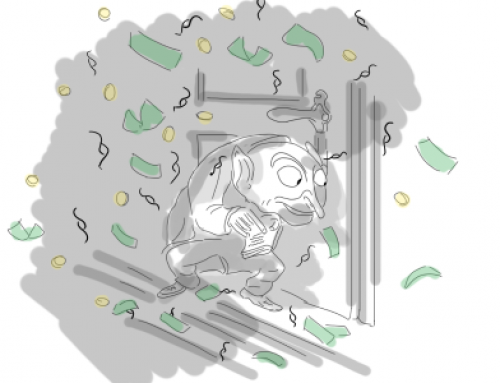„Zukunft braucht Herkunft“
Die Zukunft ist ein leeres Blatt, die Vergangenheit ein übervolles Buch. Deshalb fällt es um einiges leichter, Aussagen über die Zukunft zu machen als über die Vergangenheit. Wer über die Zukunft spricht, kann sich nach Belieben etwas ausdenken; wer über die Vergangenheit sprechen will, muss etwas von ihr wissen.
Aber ohne Vergangenheit geht es nicht. Als Odo Marquard in den 1990er Jahren die Formel „Zukunft braucht Herkunft“ prägte, war das keineswegs als bloße Floskel gemeint, sondern es war das prägnante Ergebnis einer wirklichkeitsnahen Überlegung: Das Leben ist zu kurz, um immer wieder von vorne anzufangen, und Menschen vertragen nur ein beschränktes Maß an Innovationen. Deshalb vollzieht sich der weitaus größte Teil eines menschlichen Lebens im Rahmen des durch Herkunft Bewährten, in dem Rahmen, den die Tradition vorgibt und auf den Bahnen, welche die Geschichte gezogen hat. Die großen abendländischen Traditionen der Philosophie, der Literatur, der Kunst, der Musik, aber nicht minder die kleinen Rituale des Alltags ersparen dem Menschen die Überforderung, jeden Tag die Dinge neu regeln oder „aushandeln“ zu müssen, wie man heute sagt.
Die „Herkunft“ leistet aber noch weiteres. In jüngster Zeit gehören Beschwörungen des „Zusammenhalts“ und der „Solidarität“ zum Ritual der politischen Alltagsrhetorik. Das verrät immerhin eine Ahnung davon, dass eine Gesellschaft mehr ist als eine Sammlung staatlich gegängelter Individuen und staatlich subventionierter Interessengruppen. Die Soziologie hat wieder lernen dürfen, dass der Zusammenhalt einer Gesellschaft nicht durch Geld, Recht, Macht gestiftet wird und auch nicht durch Schlagstöcke und Pfefferspray, wie neuerdings wieder empfohlen wird. Der „Zusammenhalt“ einer Gesellschaft entsteht vielmehr durch den kulturellen Überschuss, den die Geschichte in der Gegenwart abgelagert hat. Denn Menschen werden in eine Kultur hineingeboren und wachsen in ihr auf, sie formen sie und werden durch sie geformt, was einige Zeit dauert. Deshalb kann es auch nicht gut gehen, wenn allzu viele Menschen in allzu kurzer Zeit in eine Kultur übersiedeln, in die sie nicht hinein gewachsen sind – das bekommt weder denen, die schon länger da sind noch denen, die neu hinzukommen.
In seiner berühmten zweiten „Unzeitgemäßen Betrachtung“ von 1874 mit dem Titel „Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“ hat Friedrich Nietzsche vor einem Übermaß an Vergangenheitsvergegenwärtigung gewarnt. Eine übermäßige Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart könne das Leben lähmen. Das ist wohl wahr, aber davon ist die Gegenwart weit entfernt.
Falschmünzer und Erbschleicher
Als im April 2019 die Cathédrale Notre-Dame de Paris in Flammen aufging, erfasste eine Schockwelle die westliche Welt. Die Kathedrale wurde über fast zwei Jahrhunderte hinweg, vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, errichtet; sie ist eines der prägenden architektonischen Monumente christlicher Kulturtradition. Im ersten Augenblick erschien es rätselhaft, wie es mit ihr weitergehen sollte, aber inzwischen ist das Problem routiniert gelöst worden. Die denkbare Option, die Kathedrale ganz aufzugeben, wurde schnell wieder verworfen; es wäre eine spürbare Lücke geblieben. Stattdessen wurde in einer enormen finanziellen Kraftanstrengung ein Wiederaufbau in Angriff genommen, der in einigen Jahren abgeschlossen sein soll. Zugleich wird die Kathedrale, so sehen es die aktuellen Pläne vor, einer neuen Nutzung zugeführt: Der Innenraum wird eventtauglich aufgerüstet, die Beichtstühle in den Seitenschiffen sollen entfernt und durch Videoinstallationen ersetzt werden. Schließlich handelt es sich um eine Immobilie in bester Innenstadtlage mit einer sehr großen touristischen Attraktionskraft, die man schlecht brach liegen lassen kann.
Notre Dame gehörte zu jenen Monumenten der Architektur, die als gewichtige Zeugen der Vergangenheit aus fernen Zeiten in die Gegenwart hineinragen. Durch ihren bloßen Anblick schon erwecken sie jenen Eindruck der Beständigkeit, den Odo Marquard der „Herkunft“ als Aufgabe zugeschrieben hat. Aber der Schein trügt. Victor Hugo hat 1831 in seinen Roman „Notre Dame“ – cineastischen Nicht-Lesern besser bekannt als der „Glöckner von Notre Dame“ – ein Kapitel mit einer geschichtsphilosophischen Betrachtung eingeschoben, das in der Disney-Fassung verloren gegangen ist. In der Menschheitsgeschichte, so führt Hugo aus, wird das gewaltige steinerne Monument der Kathedrale im Herzen von Paris keinen Bestand haben. Es wird abgelöst werden vom geschriebenen Wort, das im gedruckten Buch verbreitet sein und das allein die Zeiten überdauern wird.
Das ist gewiss so, aber auch das gedruckte Wort bleibt dem Zugriff des Zeitgeists ausgesetzt. Der rohen Gewalt, den in der Geschichte des Buchdrucks allgegenwärtigen Verboten und Bücherverbrennungen, hat es Trotz geboten; die verbotenen und verbrannten Bücher gibt es immer noch. Aber sie sind aufs Neue gefährdet. Denn sie drohen in die Hände von Erbschleichern und Falschmünzern zu geraten. Jeder Autor, der das Pech hat, in diesen Jahren ein Jubiläum feiern zu müssen, sei es nun Theodor Fontane oder Alexander von Humboldt, muss damit rechnen, ungefragt als Kronzeuge für aktuelle Befindlichkeiten in Anspruch genommen zu werden, von der „Weltoffenheit“ bis zum „Klimawandel“ oder was auch immer gerade auf der Tagesordnung steht.
In einer eigentlich recht ordentlichen deutschen Sonntagszeitung wurde im Dezember 2021 Joseph Roths Roman „Hiob“ als „Der aktuelle Klassiker“ vorgestellt. Das ist verdienstvoll, und über den Roman lässt sich viel Gutes und Wichtiges sagen. Was sich über ihn nicht sagen lässt, ist hingegen das, was in dieser Zeitung über ihn gesagt wurde: dass nämlich der Roman von 1930 ein Beitrag zur Impfdebatte des Jahres 2021 sei, weil der Protagonist Mendel Singer gleich zu Romanbeginn einem seiner Kinder die vom Arzt angebotene Behandlung gegen Epilepsie verweigert, während er selbst die aufgezwungene Impfung als „Strafe Gottes“ akzeptiert. Von diesem Textbefund den Bogen zu schlagen zur aktuellen Impfdiskussion ist ein tollkühnes Husarenstück postmoderner Interpretationskunst, vor dem literarische Werke eigentlich geschützt werden müssen. Eine Regierung, zu deren Spezialitäten offensichtlich das Verbieten von Lebensäußerungen aller Art gehören wird, sollte ernsthaft überlegen, ob nicht auch diese Form kultureller Aneignung verbotswürdig wäre.
Zur Routine ist es inzwischen geworden, literarhistorische Werke umzuschreiben und schwarzzuwaschen, anstößige Wörter wie den historisch gut belegten Begriff „Neger“ zu entfernen und durch „PoC“ zu ersetzen. Das kann im Einzelnen durchaus amüsante Formen annehmen. Ein prominenter deutscher Verlag warnt 2021 die Leser des Romans „Der Abstinent“ von Ian McGuire in der Übersetzung von Jan Schönherr in einer „Editorischen Notiz“ vor der Lektüre der Seite 313: Hier nämlich beleidige die Romanfigur Steven Doyle „einen Schwarzen rassistisch“. Ungeschickt ist das nicht. Schon die Verleger pornographischer Literatur wussten, dass solche Warnhinweise einen erheblichen Kaufanreiz darstellen. Gute Romane überstehen auch das, und um schlechte ist es nicht schade. Das gleiche gilt für Verlage.
Die große Geschichtsverweigerung
„Historia magistra vitae“, die Geschichte sei die Lehrmeisterin des Lebens, glaubte Cicero. Ob das wirklich so ist, wurde oft und mit Grund bezweifelt. Die Geschichte hält aber gewiss ein großes Reservoir an Deutungsoptionen und Deutungsoperationen bereit, die dabei helfen können, die Gegenwart zu verstehen.
Es gibt Lehren, die auch Politiker aus der Geschichte ziehen könnten, wenn sie bereit wären, aus der Geschichte zu lernen. Das freilich setzte voraus, dass man sie kennt. Damit scheint es bei der aktuell regierenden Politikergeneration nicht zum Besten zu stehen. Führende ihrer Vertreter glauben und verkünden öffentlich, Ludwig Erhard sei ein Sozialdemokrat gewesen, die Dresdner Frauenkirche sei von „den Nazis“ zerstört worden, die türkischen Gastarbeiter hätten die Bundesrepublik wiederaufgebaut, die Berliner Mauer sei ein antifaschistischer Schutzwall und die DDR nicht nur ein Rechtsstaat, sondern auch ein Arbeiter- und Bauernparadies gewesen und Migrationsbewegungen hätten immer und überall segensreiche Auswirkungen auf die Aufnahmegesellschaft gehabt – eine Geschichtsfälschung im Übrigen, die von einem deutschen Historikerverband per Resolution zur historischen Wahrheit erhoben wurde.
Ob eine deutsche Regierung im 21. Jahrhundert ganz ohne die Kenntnis historischer Bezüge auskommen wird und ob diese sich durch eine geschichtsfreie moralische Haltung ersetzen lassen, muss sich zeigen. Ein Bundeskanzler könnte aus der Geschichte der Weimarer Republik mit ihren Notverordnungen immerhin lernen, dass jede bestandskräftige Demokratie ihre „roten Linien“ hat, die man besser nicht überschreitet. Das „Ministerium des Äußeren“ ist – man erkennt es am Genitiv – eines der vier klassischen Ministerien, deren Geschichte bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Wenn dieses Ministerium in die Hände von Personen gerät, denen man, Völkerrecht hin oder her, allenfalls eine vage Vorstellung davon zutraut, wer denn wohl Bismarck gewesen sein mag, was das 1853 von August Ludwig von Rochau definierte Wort „Realpolitik“ bedeutet, was es heißt, in einer europäischen Mittellage, zudem extrem belastet durch die jüngere Geschichte, Politik betreiben zu müssen, dann besteht Anlass zu Skepsis.
Ein Finanzminister wiederum sollte wissen, dass die Deutschen aufgrund ihrer historischen Erfahrungen ihr eigenes Verhältnis zur Inflation haben; ein Wirtschaftsminister sollte gelernt haben, dass eine staatlich gelenkte und subventionierte Wirtschaft auf Dauer nicht funktioniert und ein „Minister für Klimaschutz“ sollte sich von dem Irrglauben lösen, dass Extremwetterereignisse eine Errungenschaft sind, die durch seinen CO2-Ausstoß hervorgerufen zu haben sich das 21. Jahrhundert rühmen kann. Aus der Technikgeschichte könnte er zudem lernen, dass die Einführung komplexer Technologien oder gar elementarer Versorgungsinfrastrukturen ein langwieriger Prozess ist, der immer durch allerlei Rückschläge und Sackgassen gekennzeichnet ist und dass es nicht tunlich ist, Entwicklungsstufen zu überspringen und den dritten Schritt vor dem ersten zu machen. Und ihnen allen täte es gut, noch einmal in der „Genesis“ die Geschichte vom Turmbau zu Babel nachzulesen, jener Urszene menschlicher Vermesssenheit.
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, sagt man gerne mit Hölderlin. So auch hier: Kulturstaatsministerin der neuen Regierung ist eine gescheiterte Geschichtsstudentin, die zudem als Managerin eine eigentlich ganz erfolgreiche Politrockband in die Insolvenz führte. Vielleicht ist diese versöhnende Personalie ein Zeichen dafür, dass diese Regierung es mit sich selbst nicht gar so ernst meint, wie ihre furchterregenden wirtschafts-, klima-, finanz- und gesundheitspolitischen Programme vermuten lassen könnten.
Die „monastische Option“
Klimawandel hin oder her – es kommen wieder kältere Zeiten. Eine Gesellschaft, die ihrer eigenen Geschichte wie einem ungelösten Rätsel gegenübersteht, wird es nicht mehr weit bringen. Aber so wird wohl die Zukunft aussehen. Denn die Geschichtsblindheit der Gegenwart ist gewollt. Die Cancel-Culture-Aktivisten sind nur der militante Arm sehr viel weiter ausgreifender Bewegungen, die ihre Wurzeln im dekonstruktionistischen Jahrzehnt der 1990er Jahre haben und deren Rankengeflecht in viele Bereiche der heutigen Gesellschaft und der Politik hineinwuchert. Die universitären Kopfgeburten der Postcolonial und Gender Studies, die Queer Studies und Subaltern Studies, die Critical Race Theory und die Whiteness Theory – allesamt Universitätsdisziplinen übrigens, für die es erfreulicherweise keine deutschen Namen gibt – legen sich ihre eigene Geschichte zurecht oder glauben, ganz ohne Geschichte auszukommen.
Aber auch die avanciertesten Propagandisten der postmodernen Agenda von Frantz Fanon bis Achille Mbembe, ein Jacques Derrida, eine Gayatri Chakravorty Spivak, eine Judith Butler, eine Robin J. DiAngelo, in Deutschland eine Susan Arndt oder wie die aktuellen Insassen des Narrenschiffs auf den Wellen des Zeitgeistes auch immer heißen mögen, haben an westlichen Universitäten studiert und werden von westlichen Universitäten alimentiert. Sie alle, ob schwarz oder weiß, männlich, weiblich oder sonstwas, haben ihr Denken in der Tradition der alten weißen Männer gelernt. Ohne die abendländische Kulturtradition wären sie alle nichts. Denn die Bedingung der Möglichkeit, dass ihre Problemstellungen überhaupt auch nur thematisiert werden können, sind philosophische Traditionen und Begrifflichkeiten, die in der westlichen Welt entwickelt und an westlichen Universitäten gelehrt wurden. Auch die kühnsten avantgardistischen Gedankengebäude, ihre wildesten Phantasien haben ihre Wurzeln in der abendländischen Tradition, die hier freilich in falsche Hände geraten ist. Selbst in den bizarrsten Verrenkungen und Verzerrungen des postmodernen Zeitgeistes blieben die großen Ideen der abendländischen Denker erkennbar: Menschenwürde und Menschenrechte, Freiheit und Gleichheit, Individuum, Pluralismus, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität, Nichtdiskriminierung.
Wer zweitausend Jahre Abendland hinter sich hat, muss die Zukunft nicht scheuen, aber er muss sich vor ihr verantworten. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat Morris Berman in seinem Buch „The Twilight of American Culture“ die Empfehlung gegeben, der kulturellen Tradition des Abendlandes einen neuen Platz im sozialen Gefüge der westlichen Gesellschaften zuzuweisen. Er nennt es, in Erinnerung an die alte abendländische Klosterkultur, die „monastische Option“. Wie einst im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit die Klöster einsame Inseln der Bewahrung kultureller Überlieferung waren, so sollte in der Gegenwart eine kleine Schar „monastischer Individuen“ jene Lebensstile und Werte erhalten und weitergeben, die in den „Great Books“, den großen Büchern der abendländischen Tradition niedergelegt sind. Das populäre Leitbuch dieser Lebensweise wäre dann nicht der längst anderweitig vereinnahmte Orwell-Roman „1984“, sondern Ray Bradburys „Fahrenheit 451“ von 1953 – jener Roman, der eine Gesellschaft schildert, in der von Amts wegen jedem noch so versteckten Buch nachgejagt wird, um es – bei 451o Fahrenheit – zu verbrennen, während sich umgekehrt eine kleine Gruppe Widerständiger um einen in die Wildnis geflüchteten Literaturprofessor schart, welche die Werke der Weltliteratur auswendig lernt.
So weit ist es aber noch nicht. Im dritten Band seiner neunbändigen Romanfolge „Vergangene Gegenwart“, im Roman „Neue Zeit“ von 1975 also, lässt Hermann Lenz seine Romanfigur Eugen Rapp, die gewiss kein Romanheld ist, das Höllenfeuer des „Dritten Reichs“ und des Russlandfeldzuges mit einer einfachen Lebensweisheit überstehen: „Immer so tun als ob nix wär‘“.