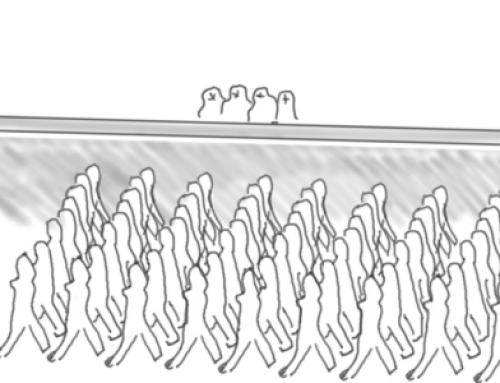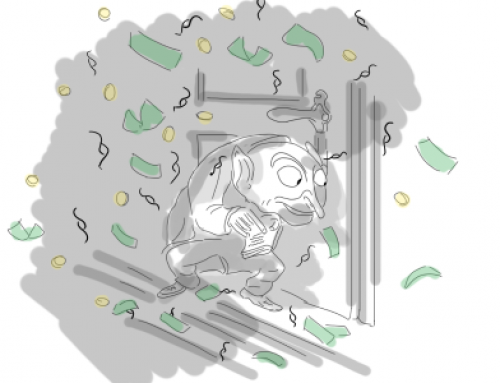Phänomenologie des Protests
„Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“ jubelte Goethes Faust 1808 bei seinem Osterspaziergang. Rund zehn Jahre zuvor hatte Friedrich Schiller, auch er ein bekannter deutscher Schriftsteller, seinem Lehrgedicht über den Gang der Kultur – „endlich entflohn des Zimmers Gefängnis“ –, ebendiesen Titel gegeben: „Der Spaziergang“. Goethe beschreibt eine Urszene bürgerlichen Selbstverständnisses, und durch Schiller wurde der Spaziergang zum bürgerlichen Kulturgut veredelt, in dem sich die ganze abendländische Menschheitsgeschichte von Homer bis zur Französischen Revolution kristallisiert.
Der Spaziergang, befreit von den Zwängen der Arbeit und des Alltags, gemeinsam mit anderen, ist ein Teil der bürgerlichen Lebensform. Im Deutschland des 19. Jahrhunderts verfestigte er sich zu einem Ritual, das bis weit ins 20. Jahrhundert hineinreicht, bevor es dann im letzten Viertel des Jahrhunderts langsam als klein- und spießbürgerliche Belustigung verächtlich gemacht wurde.
Vor einem Jahr noch hätte man sich schlechterdings nicht vorstellen können, dass das harmlose Kulturgut des bürgerlichen Spaziergangs einmal zum Gegenstand giftiger politischer Auseinandersetzungen werden würde und dass man in Anlehnung an Bertolt Brecht einmal würde fragen müssen, was das denn für Zeiten sind, in denen ein Spaziergang fast zum Verbrechen wird.
Die Spaziergänger lösen Irritationen aus. Denn sie sind gut sichtbar, sie sind mal hier und mal da, agil und ungreifbar, sie treten in lockeren Gruppen auf, sie sind eine fließende Bewegung ohne Aggressivität, ohne Sprecher oder Anführer und ohne klare politische Forderungen, nicht unähnlich der gilets jaunes-Bewegung, die vor drei Jahren Frankreichs Politik erschütterte. Die Corona-Spaziergänge sind zudem so ziemlich die letzte Möglichkeit, wo sich Geimpfte und Ungeimpfte im öffentlichen Raum treffen können, wenn auch im Schatten der Halblegalität. Sie erscheinen so als eine Bastion des Gemeinsinns in einer Zeit, in der die Impfegoisten sich mit Zähnen und Klauen an ihre Privilegien klammern, umso heftiger, je deutlicher ihnen wird, dass diese Privilegien unverdient und brüchig sind, abhängig von willkürlichen Entscheidungen, die heute so und morgen so und übermorgen wieder anders aussehen werden, von denen heute diese betroffen sind und morgen jene, die an diesen Ort gelten, aber nicht an jenem.
Der Bürger als Feind
Jeder Versuch, die Spaziergänger juristisch dingfest zu machen, streift schnell die Grenze des Rechtsstaats oder des Lächerlichen. Diese Grenze wird gerne auch einmal überschritten, wenn ein Stadtoberhaupt – in diesem Fall das des schönen Elbflorenz – „sich fortbewegende Versammlungen (Aufzüge und sogenannte ‚Spaziergänge‘)“ verbieten will, weil er nämlich die Spaziergänger als eine „maßnahmekritische Klientel“ identifiziert, die verboten gehören. Warum eigentlich? Die „Maßnahmenkritiker“ richten keinen Schaden an. Eher gilt wohl das Gegenteil: Wer diesem politischen System ernsthaft schaden will, muss nur seine Anordnungen wortgetreu befolgen. Eine Regierung, die sich von Spaziergängern bedroht fühlt, hat offensichtlich ein Problem. Philipp Gassert hat in seinem Buch über die „Deutsche Protestgeschichte“ seit 1945 – „Die bewegte Gesellschaft“ – die einfache Feststellung getroffen: „Offene Gesellschaften lassen Protest zu und lernen damit umzugehen“.
Der Verfassungsschutzpräsident weiß auch, wer hier spazieren geht: „Staatsfeinde“ – „sie lehnen unser demokratisches Staatswesen grundlegend ab“. Bereits im April 2021 hat der Verfassungsschutz deshalb ein neues „Sammelbeobachtungsobjekt ‚Demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates‘“ eingerichtet. Gemeint sind die Corona-Demonstranten. Aber die Sammelbeobachter werden auch sonst gut zu tun haben. Denn das Führungspersonal und die Mitläufer der NGOs nebst ihren Helfershelfern in Parteien und Medien und auch in Regierungsämtern eint nichts so sehr wie der Wille zur Delegitimierung des deutschen Staates zugunsten „Europas“ oder gleich einer universalen Weltgesellschaft.
Gewiss ist die Beobachtung nicht falsch, dass Querdenker und Rechtsradikale der maßnahmekritischen Bewegung wichtige Anfangsimpulse gegeben haben und dass sie unter tätiger Beihilfe der Medien weiterhin versuchen, Einfluss zu gewinnen. Aber die Querdenkerszene hat ihren Zenit längst überschritten. Eine erste Analyse der Corona-Demonstrationen durch eine Basler Soziologengruppe vom Dezember 2020 zeigt ein anderes Bild, das sich ein Jahr später verfestigt hat: Die Hauptmasse der Demonstranten sind Personen mittleren Alters, überwiegend mit guter Bildung und akademischen Abschlüssen, eher – das war eine unangenehme Überraschung für die Studienautoren – von links als von rechts kommend, viele waren ehemalige Grünen-Wähler. Das wissen auch die „Sicherheitsorgane“, wie sie die frühere Bundeskanzlerin in ihrem DDR-Jargon gerne nannte. Hinter den verschlossenen Türen des Bundestags-Innenausschusses erklärte der Präsident des Verfassungsschutzes das, was jeder mit bloßem Auge sehen konnte, sofern er kein Journalist ist: Der „überwiegende Teil“ der Demonstranten seien „normale“ Bürger.
Sie gehen nicht auf die Straße, weil sie „von rechts“ unterwandert sind, sondern die Mitte geht auf die Straße, weil sie die Mitte ist. Die Spaziergänger sind die Bürger, welche das Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften, das von der Bundesregierung, gleich welcher Couleur, und der EU großzügig in alle Richtungen verteilt wird. Das ist die bürgerliche Mitte, und wenn die auf die Straße geht, dann hat der Staat ein Problem.
Wie viele es sind, weiß man nicht genau. Nach Angaben des Verfassungsschutzes waren es an einem Tag der ersten Januarwoche 2022 über tausend Veranstaltungen mit mehr als 200 000 Menschen. Die Tendenz ist wohl steigend; zwei Wochen später sprachen schlecht verifizierbare Quellen von 2000 Veranstaltungen mit 300 000 Menschen. Ausgeschlossen ist das nicht. Die Nachrichtenlage über den Verlauf der Demonstrationen ist diffus, und der Lokalpresse sollte man ebenso wenig wie den Leitmedien trauen. Aber folgt man den zahlreichen Berichten von der Basis, dann ergibt sich auch bei den Montagsdemonstrationen ein Stadt-Land-Gefälle: Während in den Städten, das sozialdemokratisch regierte München vorneweg, gerne eine rabiate Repressionspolitik exekutiert wird – „mit Pfefferspray und Schlagstöcken“, wie es sich die Grünen-Bundestagsabgeordnete Saskia Weishaupt wünschte –, arrangieren sich in der Provinz Behörden, Polizei und Demonstranten gerne auf eine demokratiekompatible Weise. Das gilt allerdings nicht immer: Ende Januar 2022 droht die beschauliche württembergische Kleinstadt Ostfildern in einer Allgemeinverfügung ihren rund 140 spazieren gehenden Bürgern „Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder Waffengebrauch“ an. Wenn Provinzbürgermeister in einen Machtrausch verfallen, wird es eher komisch als bedrohlich. Aber wie soll das enden?
Demonstrationskultur
Am besten so, wie es sich der sächsische Ministerpräsident wünschte: „Gegen Schutzmaßnahmen zu sein ist kein Grund, auf die Straße zu gehen“, und die frisch ernannte Bundesinnenministerin verlautbarte im Regierungsmedium Twitter: „Man kann seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln“. Ganz unzufrieden ist sie aber mit ihrem Volk nicht. In einem Interview mit dem Fernsehsender „Phoenix“ erläuterte sie einem willfährigen journalistischen Stichwortgeber, dass sie der „großen Masse“ – gemeint sind die deutschen Staatsbürger – ihren „großen Respekt“ zolle, weil sie „so tapfer an der Seite der Regierung gestanden und das alles mitgetragen“ habe. Hier fehlte nur noch der Erich-Mielke-Zusatz: „Ich liebe doch alle“. Der Ministerin scheint das DDR-Modell staatlich orchestrierter Großdemonstrationen vorzuschweben, in denen das Volk am 1. Mai und 7. Oktober der Regierung huldigt.
Die Corona-Spaziergänger stehen in einer anderen Tradition. In Deutschland reicht die politische Demonstrationskultur bis ins Jahr 1832 zurück. Das „Hambacher Fest“ mit seinen 20 000 bis 30 000 Teilnehmern war nach dem Urteil Theodor Heuss‘ „die erste politische Volksversammlung der neueren deutschen Geschichte“. Auch hier waren der Ausgangspunkt nicht spektakuläre politische Freiheitsforderungen, sondern die konkreten Probleme des Alltags: Steuern, Verteuerung der Alltagsbedürfnisse, die Erfahrung alltäglicher Repression vermischten sich mit liberalen Ideen und Demokratieforderungen. Und hier musste die Staatsmacht ihre erste Lektion lernen: Repressionsversuche, Zensur, Festungshaft, drakonische Strafen bis hin zu – nicht ausgeführten – Todesurteilen erweisen sich als wirkungslos. Am Ende setzte sich der „Staatsbürger“ durch, nicht der „Untertan“. Hier hat das Demonstrationsrecht seine Wurzeln, das 16 Jahre später kodifiziert wurde. In der Paulskirchenverfassung von1848 heißt es in Art. 7 fast wortgleich mit dem heutigen Grundgesetz: „Die Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln; einer besonderen Erlaubniß dazu bedarf es nicht.“ Eine solche Tradition gibt man nicht leichtfertig auf.
Zerstörung der Lebenswelt: Es geht nicht um Corona
Unmittelbar nach der friedlichen Revolution von 1989, welche das durch politische und wirtschaftliche Missstände längst marode gewordene Kartenhaus der sozialistischen Ostbockstaaten hinwegfegte, prägte Jürgen Habermas den Begriff der „Nachholenden Revolution“ – einer seiner vielen Buchtitel, die zum geflügelten Wort wurden. „Nachholend“: Damit war gemeint, dass sich die Bürger der Ostblockstaaten das holten, was die im Westen schon hatten, Demokratie und Wohlstand nämlich, wie Habermas leicht abschätzig vermerkt. Aber Demokratie und Wohlstand sind nicht wenig, obwohl mancher unter den DDR-Dissidenten wohl ein bisschen mehr erwartet hatte als das, was er bekommen hat.
Und darum geht es auch bei den Corona-Spaziergängen. Es geht nicht um Corona, es geht nicht einmal um die Corona-Politik. In den Spaziergängen verdichtet sich vielmehr ein Unbehagen an politischen und mehr noch gesellschaftlichen Entwicklungen, welche Schritt für Schritt die bürgerliche Lebenswelt zerstören. Wer noch eine statistische Bestätigung des Offensichtlichen benötigt, kann jetzt mit einer aktuellen Allensbach-Umfrage über die wachsende Unzufriedenheit in der deutschen Bevölkerung zufrieden gestellt werden. In diese Stimmungslage fügen sich die Spaziergänge ein.
Denn sie sind weit mehr als nur Protest gegen eine irrlichternde Corona-Politik, wie auch diese weit mehr ist als Ausdruck eines multiplen Regierungsversagens. Hier deuten sich Verwerfungen an, die tiefer reichen, Risse im Gebälk der Gesellschaft. Deshalb erscheinen sie auch gefährlicher als jene blindwütigen Gewaltaktionen im Hambacher Forst, in der Rigaer Straße, in Leipzig-Connewitz, mit denen sich Politik und Medien ebenso arrangiert haben wie mit den alltäglichen Rechtsbrüchen der Klimaaktivisten, den Blockaden von Straßen, Autobahnen, öffentlichen Plätzen, Fußballstadien. Aber die Spaziergänge sind brisanter. Denn in ihnen verschafft sich eine bürgerliche Lebensform Gehör, keine Krawallkultur.
Es geht nicht nur um die Bürgerrechte, sondern um das bürgerliche Leben in seiner elementaren Form. Es ist ein alter Befund, dass die Bürger in demokratischen Gesellschaften lieber auf ihre Grundrechte – ihre „Freiheiten“, wie man heute sagt – als auf die Sicherheit verzichten, die ihnen der Staat verspricht. Aber wenn der Staat auch dieses Versprechen nicht mehr halten kann oder halten will, dann untergräbt er seine eigene Legitimation. Wenn man nicht mehr darauf vertrauen kann, dass das Geld seinen Wert behält, dass die Wohnung morgen noch geheizt werden kann und übermorgen noch genügend Strom für das Elektroauto da ist, dann hat der Staat das Vertrauen seiner Bürger verspielt. Diese Entwicklungen haben mit der Währungspolitik begonnen, sich in der Flüchtlingspolitik fortgesetzt und sie verdichten sich in der Corona-Politik.
Wer noch über ein einigermaßen intaktes coronapolitisches Urteils‑ und Erinnerungsvermögen verfügt, wird sich vergegenwärtigen, dass heute nichts mehr von dem gilt, was vor einem Jahr noch als unumstößliche wissenschaftliche Wahrheit und politische Weisheit verkündet wurde. Seit dem Beginn der Pandemie vor zwei Jahren haben 31 Bund-Länder-Konferenzen stattgefunden. Bei ungefähr jeder zweiten wurden abrupte maßnahmenpolitische Kurswechsel vorgenommen, bis am Ende weder die Adressaten noch die politischen Akteure selbst wussten, was gerade gilt und was nicht gilt. Diese elementare Unsicherheit macht den Normenstaat zum Maßnahmenstaat, sie höhlt den Rechtsstaat aus und unterminiert die Lebenswelt. Das ist gewiss gefährlicher als die Gewaltphantasien eines kommunalpolitischen Revolverhelden.
Selbst die Treuesten der Treuen unter den medialen Hilfstruppen können sich nicht mehr auf die Regierung verlassen. Eine Hamburger Zeitgeistzeitschrift rückte am 11. Januar 2022 einen etwas wirren Artikel ins Blatt und ins Netz, in dem gleich zwei Professoren – auch zwei Köche können schon den Brei verderben – gegen die gefährliche liberale Verirrung der „Eigenverantwortung“ zu Felde zogen, weil „fundamentale Systemgegner der Neuen Rechten, anthroposophische Naturfetischisten und religiöse Fundamentalisten“ sich darauf beriefen. Stattdessen empfahlen sie den Corona-Bürgern, „solidarisch“ zu sein und ihr Geschick vertrauensvoll in die Hände des Staates zu legen. Zwei Wochen später empfahl die Bund-Länder-Konferenz das Gegenteil: Die Bürger möchten doch bitte so freundlich sein, ihre Corona-Probleme selbst in die Hand zu nehmen und „eigenverantwortlich“ mit „etwaigen Erkrankungen“ umgehen. So schnell ändert sich die Zeit.
Die „rote Linie“
Kurz nach seiner Vereidigung erklärte der an sich recht wortkarge Bundeskanzler, dass es bei den Corona-Maßnahmen keine „roten Linien“ geben werde. Unmittelbar darauf waren auf den Straßen Transparente zu sehen: „Wir sind die rote Linie“. Ob der Kanzler wirklich weiß, was er da gesagt hat? Die Metapher der „roten Linie“ stammt aus dem Krimkrieg. Hier hatte im Oktober 1854 in der Schlacht bei Balaclava ein rot gewandetes schottisches Regiment als „Thin Red Line“ einem übermächtigen russischen Angriff standgehalten. Wie der Krimkrieg ausgegangen ist, weiß man ja: Die rote Linie hat gewonnen.