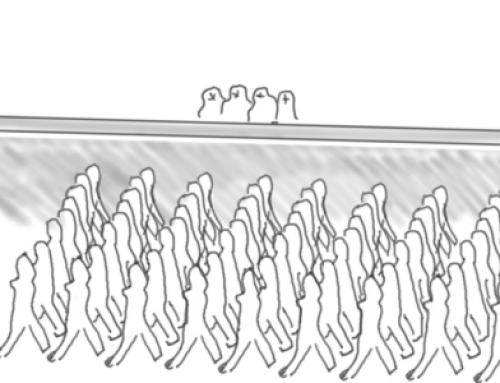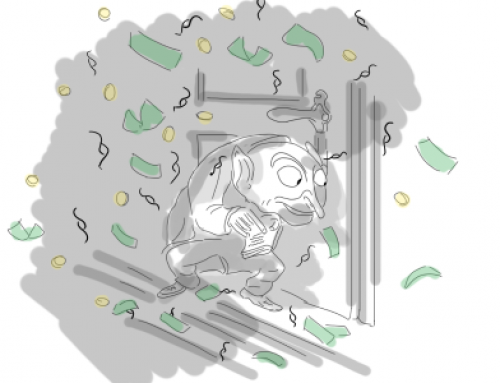Kriegsweihnachten
Wie wird es diesmal sein? Zwei Jahre lang durften die Deutschen ihr Weihnachtsfest nicht so feiern, wie sie es gewöhnt sind. Einen solchen Eingriff in die weihnachtliche Festkultur hat es seit über zwei Jahrhunderten nicht gegeben. Auch in den düstersten Kriegs- und Krisenzeiten wurde Weihnachten gefeiert. Erst dem Corona-Regime der deutschen Bundes- und Landesregierungen ist es gelungen, dieser Tradition der Unanfechtbarkeit des Weihnachtsfestes ein Ende zu bereiten. In diesem Jahr sieht es anders aus. An Corona glauben nur noch der zuständige Minister und die Treuesten unter seiner Gefolgschaft, die im Straßenbild leicht zu erkennen sind.
Ein Hauch von Kriegsweihnacht wird sich über die Adventsstimmung legen. Die Inflation ist real und die Gefahr einer Stromrationierung immerhin nicht abwegig. Um ein Zeichen zu setzen, hat das Bundeskanzleramt angekündigt, man werde den Weihnachtsbaum nur von 16 bis 20 Uhr beleuchten. Anschließend herrscht das Reich der Finsternis. Die Bundesregierung signalisiert damit, dass der Staat nicht mehr in der Lage sein könnte, elementare Versorgungsleistungen für seine Bürger zu garantieren. Zugleich wird die Rolle des Weihnachtsmanns neu besetzt: Die Bundesregierung verteilt großzügige Geschenke an ihr Volk, das sich wohl nicht ganz darüber im Klaren ist, dass es diese Großzügigkeit selbst teuer bezahlen wird.
Ein Leben ohne Verbote scheint den Deutschen in diesen Jahren zwar möglich, aber wenig wünschenswert zu sein. Zumindest die Lichterketten in den Innenstädten und den privaten Gärten sollen ausgeschaltet oder doch nach Kanzlervorbild reduziert werden, darauf werden die Nachbarn schon achten. Die Weihnachtsgans soll den Deutschen im Hals stecken bleiben, weil sie nicht vegan ist, und in der Woche nach Weihnachten sollen die Deutschen den Übergang ins neue Jahr still vor sich hin feiern, denn die traditionellen Silvesterböller werden voraussichtlich behördlich verboten sein.
Aber wirklich erfolgreich scheinen die medialen und politischen Bemühungen zur Störung der Weihnachtsstimmung nicht zu sein. Die Weihnachtsmärkte finden statt und sind gut besucht, Bachs Weihnachtsoratorium ist wieder konzertant zu hören und wird allenfalls mit halbherzigen Aufforderungen zum freiwilligen Maskentragen getrübt, die Inflation dämpft zwar die saisonübliche Kauflust, vermag sie aber nicht zu ersticken, und selbst die Meteorologen sagen, wenn auch widerwillig, winterliche Temperaturen voraus.
Diese Rückkehr zur Normalität auch unter erschwerten Bedingungen ist nicht überraschend. Menschen brauchen Feste. Philosophen, Soziologen, Ethnologen, Anthropologen haben lange darüber gegrübelt, warum das so ist. Die Antwort ist einfach: Feste gliedern die Zeit im Jahresverlauf, aber sie lassen auch die Zeit stillstehen, weil ihre Rituale die Zeitläufte überdauern. Feste sind oft mit religiösen Sinnstiftungsangeboten verbunden, aber diese Aufgabe können auch säkulare, vor allem nationale Ideologien übernehmen. Und schließlich unterbrechen Feste die Routinen der alltäglichen Lebenswelt. Immerhin lässt sich das Bedürfnis nach einem Festtag, dem siebten, dem Ruhetag, zurückverfolgen bis in die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments: „Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken“. (1. Mose 2:3)
Es ist sicher kein Zufall, dass Diktaturen immer wieder versucht haben, ihren jeweiligen Gesellschaften einen neuen Festrhythmus aufzuzwingen – wer über die Feste herrscht, herrscht über den Alltag, den Lebensrhythmus, schließlich auch über die Gemütslage der Menschen. Die Französische Revolution schuf ihren eigenen Festkalender, ebenso die Sowjetunion, das „Dritte Reich“ und die DDR. Stets ging es darum, die Deutungsmacht der christlichen Tradition über das Alltagsleben zu brechen und ihm einen neuen Rhythmus aufzuerlegen – der „neue Mensch“ braucht auch einen neuen Alltag. Funktioniert hat das nie. Der christliche Festkalender, wie säkularisiert die einzelnen Feste inzwischen auch immer geworden sein mögen, hat seine Beharrungskraft bewahrt.
.
Die Weihnachtsfeier
Weihnachten ist in Deutschland seit über zwei Jahrhunderten der Höhepunkt des jährlichen Festzyklus. Dass es so gekommen ist, ist einerseits Zufall, denn theologische Gründe hat das nicht. Folgt man der christlichen Festhierarchie, dann steht Ostern, das Fest der Auferstehung, an erster Stelle.
Wenn Weihnachten nur ein christliches Fest wäre, stünde es schlecht um seine Zukunft. Aber der religiöse Gehalt ist nur das eine. Daran kann man glauben oder auch nicht. Wer in der deutschen Gesellschaft ernsthaft daran glaubt, gehört nicht mehr zu Mehrheit.
Aber Weihnachten ist mehr. Weihnachten ist das Fest des deutschen Bürgertums; es hat seinen Sitz im Leben der deutschen Gesellschaft. Natürlich weiß man, dass die Weihnachtsfeiern in ihrer heutigen Form auf keine allzu lange Tradition zurückblicken können. Zum Fest der bürgerlichen Familie und zum Inbegriff deutscher Gemütlichkeit wurde Weihnachten erst im 19. Jahrhundert; hier entwickelten und verdichten sich die Insignien, Symbole und Rituale, an die man heute denkt, wenn man den Verlust weihnachtlicher Traditionen beklagt. Der symbolische Inbegriff des deutschen Weihnachtsfestes, der Weihnachtsbaum, lässt sich in seinen Vorläufern zwar bis in die Reformationszeit zurückverfolgen, seine volkstümliche Verbreitung verdankt er aber erst dem deutsch-französischen Krieg 1870/71: Der preußische König hatte angeordnet, dass in den soldatischen Unterkünften und Lazaretten ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden solle.
Das Weihnachtsfest ist ein zentraler Bestandteil der nationalen Festkultur in Deutschland, aber es ist kein Nationalfest. Es ist ein Familienfest. Der große Theologe Friedrich Schleiermacher hat 1806 eine längere Betrachtung über „Die Weihnachtsfeier“ geschrieben. Er beschreibt die Weihnachtsfeier als ein Fest des religiösen Empfindens und der Frömmigkeit. Vor allem aber ist sie ein privates Fest, das alle feiern, aber jede Familie für sich; und weil Weihnachten ein Familienfest ist, ist es auch ein Kinderfest.
In den mehr als zwei Jahrhunderten, die seit Schleiermachers Betrachtung vergangen sind, ist vom religiösen Empfinden und von der Frömmigkeit nicht mehr viel übrig geblieben. Sicher haben die Kritiker Recht, die seit Jahrzehnten die rigorose Kommerzialisierung und Verkitschung des Weihnachtsfestes und der Adventszeit beklagen oder, je nach politischer Ausrichtung, begrüßen. Aber gerade diese Anpassungsfähigkeit ist es ja gewesen, die das Weihnachtsfest lebendig gehalten hat und alle Stürme des Zeitgeistes überstehen ließ.
Im jährlichen Festkalender hatte Weihnachten einen unangefochtenen Platz. In diesem Jahr 2022 ergibt sich jedoch die sonderbare Konstellation, dass zwei festliche Großereignisse in einen Konflikt miteinander geraten. Die christliche Adventszeit kollidiert mit der säkularen Fußballweltmeisterschaft. Parallel zur Adventszeit findet im fernen Qatar die Fußweltweltmeisterschaft statt und absorbiert einiges von der deutschen Aufmerksamkeit, die ansonsten uneingeschränkt der Vorweihnachtsstimmung gehört. Denn auch Fußball hat seinen festen Platz im bundesdeutschen Festkalender. Das „Wunder von Bern“ war der gänzlich unvermutete Gewinn der Fußballweltmeisterschaft durch die nach dem Krieg erstmals wieder zugelassene westdeutsche Nationalmannschaft am 4. Juli 1954. Dieses Sportereignis gehörte ein halbes Jahrhundert lang zu den Mythen der nationalen Selbstvergewisserung: „Wir sind wieder wer“, hieß es bei den Zeitgenossen und noch lange danach. Irgendwann nach der Jahrtausendwende ging es damit zu Ende. Wer jetzt die Fußballmannschaft zum Gradmesser von Deutschlands Ansehen in der Welt machen wollte, müsste zur Einsicht kommen: „Wir sind niemand mehr“. Das wäre ja auch nicht das Schlechteste, wenn man es nur einsehen würde.
Die Konkurrenz der Botschaften
Jahrzehntelang sind sich Fußball und Weihnachten nicht in die Quere gelkommen, Weihnachten war im Winter, Fußball im Sommer, Weihnachten war ein religiöses Fest, Fußball eine weltliche Freizeitunterhaltung, und wenn es ums Geschäft ging, ließ sich das eine mit dem anderen gut verbinden: Die Merchandisingartikel des Fußballs eignen sich hervorragend als Weihnachtsgeschenke. Ginge es bei der Konkurrenz zwischen Weihnachten und Fußballweltmeisterschaft bloß um die Anteile an medialer Aufmerksamkeit, könnte man sich arrangieren. Aber dieses Mal steckt mehr dahinter.
Das Weihnachtsfest hat eine Botschaft. Im Weihnachtsevangelium nach Lukas findet sich in Luthers Übersetzung ein Satz, der im alten Wertekosmos des Abendlandes einen hohen Rang innehatte: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ (Lk 2,14) Der Deutsche Fußballbund hat ebenfalls eine Botschaft. Sie ist auf dem Flugzeug aufgemalt, das die Fußballspieler zu ihrem Arbeitsplatz brachte: „Diversity wins“ heißt diese Botschaft, die nach dem Willen und den Worten des Deutschen Fußballbundes „in die Welt“ getragen werden soll. Auf dem Platz ist sie nicht angekommen. Der Deutsche Fußballbund brachte beim ersten Spiel eine Mannschaft aufs Feld, bei der sechs der 16 eingesetzten Spieler, also 37,5 Prozent, einen Migrationshintergrund hatten. Gewonnen haben die anderen, die Japaner. Japan ist neben Polen die ethnisch homogenste Nation auf dem Globus.
Aber es kam noch schlimmer. Zum großen Erstaunen deutscher Politiker hat die Weltmeisterschaft in Qatar gezeigt, dass es Länder gibt, „die unsere Werte nicht teilen“, mehr noch: dass „wir“ von diesen Ländern abhängig sind. Man musste zur Kenntnis nehmen, dass in Qatar andere Wert- und Rechtsvorstellungen herrschen als in Deutschland und dass man in Qatar nicht die geringste Einsicht zeigt in die Überlegenheit des westlichen Systems diverser Werte. Der Versuch, mit Armbinden Zeichen setzen zu wollen, prallt an der unerschütterlichen Selbstsicherheit eines arabischen Staates ab, der über das Erdgas verfügt, das die Deutschen gerne haben würden. Qatar ist nach Australien der zweitgrößte Exporteur von Flüssiggas. In Politik und Medien muss man mühsam wieder lernen, was der Volksmund schon immer wusste: Andere Länder, andere Sitten.
Was kommt danach?
Wie es weitergehen wird, ist schwer vorherzusagen. Dass der aktuelle „Diversity“-Kult sich wirklich etablieren kann, darf man bezweifeln. Dazu fehlt ihm die Verankerung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, von seiner Kultur- und Geschichtslosigkeit ganz zu schweigen. Selbst im eigenen Milieu kann er sich nur schwer durchsetzen. Zwar hat der deutsche Fußballbund das Flugzeug bunt anmalen lassen, aber eine alte Fußballregel besagt: „Die Wahrheit ist auf dem Platz“, und auf dem Platz waren keine bunten Farben zu sehen. Auf dem Platz war das Regenbogensymbol schlicht verboten und kein Fußballoffizieller hat es gewagt, gegen dieses Verbot zu verstoßen. Stattdessen hat man ersatzweise ein Logo lanciert, das so aussieht, als ob man einem Viertklässler ohne Gymnasialempfehlung ein paar Buntstifte in die Hand gedrückt habe. Eine deutsche Tageszeitung klagte darüber, dass das „One-Love-Zeichen“ völlig „entschwult“, frei erfunden und nicht einmal in der eigenen Wertegemeinschaft verankert sei.
In der Tat: Wenn es ernst wird, ist niemand, und schon gar kein Fußballfunktionär, bereit, für „unsere Werte“ einzustehen. Niemand, außer der deutschen Innenministerin. Sie ließ sich dafür feiern, dass sie der Niederlage der deutschen Mannschaft als Repräsentantin der Bundesregierung beiwohnte und dabei eine bunte Armbinde trug. Die Ministerin ist 1970 geboren. Ihr sind wohl nicht mehr die Bilder aus jener Zeit vor Augen, in der deutsche Politiker ihre Gesinnungs‑ und Parteizugehörigkeit durch Armbinden zum Ausdruck brachten. Dass sie als Repräsentantin der deutschen Regierung gekleidet war wie eine Ballermann-Touristin, fällt dagegen kaum noch ins Gewicht.
Dass Weihnachten durch den „Diversity“-Kult verdrängt werden wird, ist nicht zu erwarten. In der neuen Festkultur würde der Christopher Street Day ganz oben in der Hierarchie der Feste stehen. Darauf sind die christlichen Kirchen eingestellt. Inzwischen nehmen sie selbst schon an Christopher-Street-Day-Paraden teil, und eine evangelische Sozialeinrichtung beteiligte sich als Hauptsponsor an einem Christopher-Street-Day-Umzug in Nürnberg, statt die üblichen Spenden nach Afrika zu schicken.
Aber das wird nichts nutzen, denn darum geht es gar nicht. Die kulturellen Frontlinien verlaufen anders, nicht zwischen Christopher Street Day und Adventszeit, nicht zwischen „Diversity“- und „Friedensbotschaft“. An den deutschen Schulen – und an den Außengrenzen der Europäischen Union – wird der Kulturkampf der Zukunft ausgefochten und nicht auf den Fußballplätzen. Was deutsche Schulkinder über „Diversity“ wissen, ist ungewiss; dass sie aber mehr über den Ramadan und das Zuckerfest als über die Adventszeit und Weihnachten wissen, darf man annehmen. Das ist auch nicht ganz verkehrt, denn in ihrem Erwachsenenleben wird ihnen das eine nützlicher sein als das andere.
In Qatar kann man sehen, wie es geht. Dort hat man keine Scheu, politisch durchzusetzen, was man kulturell für richtig hält. Das wird es in Deutschland nicht mehr geben. Aber vielleicht kann man wenigstens etwas vom Fußball lernen. Im Fußball müssen alle nach den gleichen Regeln spielen. Auf dem Spielfeld kann man nicht jede Situation neu aushandeln, wie fortschrittliche Kreise sich das für die multikulturelle Gesellschaft in Deutschland wünschen. Auf dem Fußballplatz gibt es Regeln, und wer sich partout nicht an diese Regeln halten will, wird vom Platz gestellt, ungeachtet seiner Hautfarbe und seiner sexuellen Orientierung. So einfach könnte das sein.
***
Am Sonntag, 27. November 2022, wurde im „Kontrafunk“-Internetradio in der Reihe „Audimax – das Kontrafunkkolleg“ der Hörfunkvortrag
„Furcht und Zittern.
Vom Erdbeben zum Klimatod: Katastrophen und ihre Folgen “
von Peter J. Brenner gesendet. Die Sendung ist im Podcast hier verfügbar.