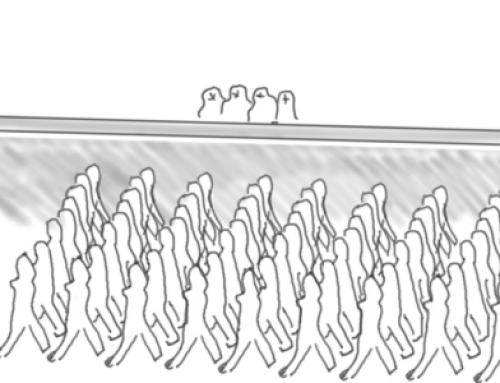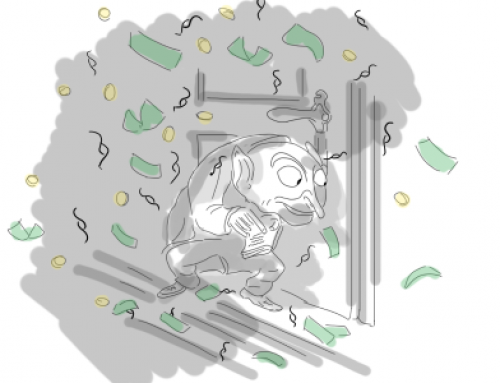Zur Lage der Satire in Deutschland
Wer hätte das gedacht: Die Deutschen haben ja doch Humor. In diesen Krisenmonaten entpuppt sich Deutschland als Land der Satiriker. Gleich zu Jahresbeginn ging es los: Der Westdeutsche Rundfunk versendete einen umgeschriebenen Gassenhauer aus den 1930er Jahren, in dem einer Großmutter ein nicht Greta-konformer Lebensstil vorgeworfen wurde. Angesichts des Proteststurms fiel den Verantwortlichen im Nachhinein, aber gerade noch rechtzeitig, ein, dass es sich um Satire gehandelt haben müsse. Diese sei als solche jeder Kritik enthoben, vielmehr mache sich jeder Kritiker daran selbst verdächtig.
Den zweiten Höhepunkt der neuen deutschen Satirewelle markierte eine nichtbinäre Person namens Hengameh Yaghoobifarah, ursprünglich Apothekerstochter aus Buchholz in der Nordheide, mit einem Kommentar in der renommierten tageszeitung vom Juni 2020. Hier erklärte sie (oder er oder es) wenig menschenfreundlich, irgendwie seien Polizisten auf der Müllhalde besser aufgehoben. Davon versteht sie (oder er oder es) etwas, denn nach seiner (oder ihrer) Selbstbeschreibung ist er (oder sie oder es) „Autor_in, Redakteur_in und Referent_in zu Queerness, Feminismus, Antirassismus, Popkultur und Medienästhetik“. Der Müll-Text war, wie diese Selbstbeschreibung erahnen lässt, nicht sonderlich witzig. Aber was danach kam, war bestes Kabarett: Der Bundesinnenminister ersuchte um eine Audienz bei der Redaktion, die ihm indes nicht gewährt wurde.
Als die Kritik an dem Beitrag auch in der eigenen Anhängerschaft allzu stark anschwoll, schickte die Redaktion einen Anwalt ins Rennen, der sich auf das wdr-Modell besann und den Text zu einem „satirisch geformten […] Gedanken“ – nun auch das noch – erklärte. Diese Deutung erhielt bald die höchste aller denkbaren Weihen: Ein F.A.Z.-Redakteur teilt ex officio per Twitter mit: „Dass Yaghoobifarahs Text als Satire aufgefasst werden möchte, erschließt sich schon nach wenigen Zeilen, als er den Boden des Realen verlässt und sich dem Imaginären zuwendet.“ Diese erhellende Erläuterung des Wissenschaftsredakteurs und Kulturkorrespondenten einer überregionalen Zeitung – in Bayern nennt man solche Leute Siebeng‘scheiterl – war genau das, was der Angelegenheit noch gefehlt hatte, um ihr den letzten satirischen Schliff zu geben. Für Yaghoobifarah hat sich das Ganze übrigens gelohnt: Es wurde vom Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe als Model für eine Werbeanzeige für Luxuskleidung angeworben.
Nicht immer ist es so einfach wie im Fall des wdr und der taz, sich auf die Satire herauszureden, nachdem man sich hineingeritten hat. Dafür muss man schon auf der richtigen Seite stehen. Denn Satire kann ziemlich kompliziert werden, so kompliziert, dass sich oft Juristen damit befassen müssen, zu deren Berufsbild es gehört, schwierige Dinge einfach zu machen. Das ist in einem Fall der publizistisch vielfach gewürdigten rechtsextremen Chat-Gruppen in Nordrhein-Westfalen geschehen: Eines der von einer Polizistin per WhatsApp geteilten Hitler-Bilder entpuppte sich als ein Hitler-Darsteller mit Weihnachtsmannmütze und Rentiergeweih. Damit standen die Richter vor der schwierigen Frage, ob es sich um die strafbare Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86 Abs. 3 StGB handelt oder um die gemäß § 189 StGB ebenso strafbare Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Das Gericht entschied sich für eine salomonische Lösung: Es befand, dass es sich um eine Parodie handelt, die derzeit noch nicht strafbar ist, und hob die Suspendierung der Polizistin auf. Allerdings fand diese Meldung in der Presse nicht mehr auf den Titelseiten, sondern nur noch unter „Vermischtes“ ihren Platz.
Politik und Satire
Eine kurze öffentliche Erregungswelle verursachte im September 2020 die entgleiste Formulierung in einem Kommentar des Kolumnisten Stefan Paetow über die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli im Online-Magazin Tichys Einblick. Da die Politikerin einen Migrationshintergrund hat, gab es einen schrillen Aufschrei, der sich kurioserweise nicht gegen den Autor, sondern den Herausgeber des Magazins richtete. Aber das ist eine andere Geschichte.
In der Sache handelte es sich nicht um eine Satire gegen eine Berliner Politikerin, sondern eher um eine Rangelei unter konkurrierenden Satirikern. Paetow gelingen in der Regel lesenswerte, mit sanfter Ironie und gelegentlichem Sarkasmus formulierte Kommentare zum aktuellen Politik- und Mediengeschehen. Aber Sawsan Chebli ist eindeutig begabter. Die studierte Politologin war stellvertretende Pressesprecherin des Auswärtigen Amtes unter Dr. jur. Frank-Walter Steinmeier. In dieser Funktion hat sie ihre satirische Kompetenz vielfach unter Beweis gestellt. Auf die Frage nach der völkerrechtlichen Legitimation eines Bundeswehreinsatzes in Syrien antwortete sie im Juli 2015 auf der Bundespressekonferenz:
„Das, was Syrien angeht, da haben wir, da haben wir die internationale Koalition, die, die in, also Amerikaner, die Amerikaner und weitere Staaten. Die Notwehr, das völkerrechtliche Mandat war ja Notwehr sozusagen, der, um dem Irak zur Hilfe zu kommen. Und jetzt ist es auch so, dass natürlich die Türkei. Grundsätzlich gibt es auch im Völkerrecht unter bestimmten Bedingungen das Recht auf Notwehr gegen Angriffe, und das ist jetzt auch in diesem Fall der Fall.“
Das ist großes Kabarett. Der geniale Stotterer und Meister des Anakoluths Werner Finck hätte es kaum besser hinbekommen. Mit ihrer B-Besoldung war Chebli damals sicher die bestbezahlte Kabarettistin im öffentlichen Dienst. Inzwischen hat sie allerdings das Fach gewechselt, wie die Neue Zürcher Zeitung beobachtete: Jetzt redet sie bei ihren öffentlichen Auftritten nicht mehr über Politik, sondern über sich selbst, wo sie sich auch eindeutig besser auskennt: Im August gab sie bekannt, dass sie gerade „selbst Mutter eines dreijährigen Kindes geworden“ sei.
Seit ein google-kundiger Journalist im Zuge der wdr-Diskussion die einschlägige Textstelle gefunden hat, wird Kurt Tucholsky neuerdings gerne mit dem Befund zitiert, Satire dürfe alles. Aber aus einem von Tucholskys „Schnipseln“ von 1932 stammt auch die gegenteilige Warnung, dass die Satire oben wie unten ihre Grenze habe: „so tief kann man nicht schießen“, dass man Ende auch noch Saswa Chebli trifft. Anders gesagt: Chebli ist selbst eine begabte Satirikerin, aber als Objekt von Satire taugt sie nichts, das hätte Paetow bedenken sollen.
Chebli spielt politisch in der zweiten, eher sogar in der dritten Liga. In der ersten Liga, dem Bundestag, fällt man etwas zurück, seit ein Herbert Wehner oder ein Franz Josef Strauß dem Parlament nicht mehr angehören. Aber man bemüht sich. Nachdem 2013 die spätere und inzwischen ziemlich geräuschlos versorgte Arbeitsministerin mit den Absingen eines Kinderliedes vor dem deutschen Bundestag neue Maßstäbe der Infantilisierung gesetzt hat, versuchte sich, sieben Jahre später, die damalige wie heutige Bundeskanzlerin bei ihrer Regierungserklärung zu den gerade beschlossenen Corona-Einschränkungen auch einmal, noch recht ungelenk, im gleichen Fach. Ihre Redenschreiber hatten ihr ein Zitat der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim aufgeschrieben, mit dem die Bundeskanzlerin am Ende ihrer Rede ihre „tiefe Überzeugung beschreibt“: „Es geht hier um unsere Haltung zu dem Virus, das – man stelle sich einmal vor, es könne denken –, von sich denken würde. Ich zitiere: ‚Ich hab‘ hier den perfekten Wirt. […] Also besser kann es gar nicht sein.‘ Und weiter sagte sie, wieder aus der Perspektive der Menschen: ‚Nee, Virus. […] Wir werden Dir zeigen, dass Du Dir den falschen Wirt ausgesucht hast! (Applaus)“. In der Vorstellungswelt der Bundesregierung kommen also denkende Viren vor. Mit denkenden Bürgern scheint man eher weniger zu rechnen.
Da war der Versprecher schon amüsanter – und als Freudsche Fehlleistung erhellender –, mit dem die Bundeskanzlerin in der gleichen Rede kurz zuvor bei ihrer Bevölkerung um Verständnis für die Maßnahmen der Bundesregierung warb: „Nicht jeder von uns muss dabei einen Beitrag leisten …“. In den Untertiteln der Internet-Version hat man das deutlich ausgesprochene „nicht“ dann doch lieber weggelassen.
Öffentlich-rechtliche Geschäftsmodelle: Welcke und Böhmermann
In jüngerer Zeit hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen seinen Narren an den Kabarettisten, Satirikern, Komikern, Comedians oder wie die Berufsbezeichnungen gerade heißen, gefressen, die – vielleicht aus gutem Grund? – mehr und mehr die Rolle von Journalisten und Politikern übernehmen. In den Nachrichtensendungen und Politiktalkshows des Sommers 2020 erhielten sie zahlreiche Auftritte. Der Comedian Marius Jung wurde am 7. Juni 2020 im „heute journal“ von Marietta Slomka über Rassismus befragt, am 7. Oktober 2020 wurde der Komiker Bernhard Hoëcker bei Maischberger als Experte für Donald Trump herangezogen, der alte Haudegen Jürgen von der Lippe war, weil sich sonst niemand traute, zwei Tage vorher als Gast bei „Hart aber fair“ für kritische Bemerkungen über Political Correctness zuständig, und zuvor hatte Maybrit Illner zu ihrer Rassismus-Sendung vom 25. Juni 2020 die Kabarettistin Idil Baydar als Expertin für irgendetwas eingeladen. So entsteht die seltsame Konstellation, dass man Satire nicht mehr ernst nehmen kann.
Aber das ist nur mediales Treibgut. Die stabilen Anker des Polit-Comedy-Geschäftes im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben ihre eigenen Sendungen. In einer einzigen Woche versendet allein die ARD über ein Dutzend Formate, die in irgendeiner Form zur Rubrik „Kabarett und Comedy“ gehören und zum guten Teil einen mehr oder minder ausgeprägten politischen Anspruch haben. Am prominentesten platziert ist zurzeit Dieter Nuhr, der nach dem Motto der Echternacher Sprungprozession – vier Schritte nach rechts und dann mindestens so viele nach links – auch mal was gegen die Regierungspolitik sagen darf. Das ZDF kann seiner Struktur gemäß nicht ganz so viele Sendungen anbieten, hat aber die beiden Marktführer „heute show“ und „Neo Magazin Royale“ im Angebot. Ihnen wird glaubhaft nachgesagt, ihr politischer Einfluss sei größer als der der eigentlichen Nachrichtensendungen.
Aber die vielgerühmte Sendung „heute show“ mit Oliver Welke hat ihre dunklen Seiten, so harmlos sie auch daherkommt. Sie ist ja meistens ganz witzig, je nach Tagesform der Witzelieferanten im Hintergrund. Aber wer genau hinschaut, erkennt das Muster: Scharen von Mitarbeitern werden losgeschickt, um Videoschnipsel zu finden, mit denen sich politisch unerwünschte Menschen lächerlich machen lassen, die keine paar Auslandssemester an der Sorbonne oder in Harvard verbracht oder wenigstens eine Journalistenschule besucht haben und sich deshalb nicht ganz so gewählt ausdrücken können. Nicht nur wird das auf Dauer langweilig, es hat auch einen menschenverachtenden Grundzug, der einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Aber das gehört zum Satiresystem des ZDF.
Der Meister der Satire ohne Witz und Geist ist indes Jan Böhmermann. Von 2013 bis 2019 durfte er mit seinem Fernsehmagazin „Neo Magazin Royale“ im ZDF auf Kosten der Beitragszahler allwöchentlich seinen Geschäften nachgehen und seinen Markennamen pflegen, ab November 2020 nimmt er nach einer Pause seine Geschäfte wieder auf, diesmal im Hauptprogramm des ZDF. Seinen eigentlichen Ruhm erhielt er aber nicht durch seine mal mehr, mal weniger aufschlussreichen investigativen Recherchen, die mal weniger und mal noch weniger satirisch aufbereitet werden. Seinen eigentlichen Ruhm verdankt er seinen Twitter-Flegeleien, von denen er in den letzten zehn Jahren über 25 000 in die Welt hinaus gesendet haben soll, also etwa 6,9 pro Tag. Die Satire entlarvt ihren Urheber mindestens im gleichen Maße wie ihren Gegenstand, auch das kann man bei Tucholsky nachlesen.
Schützt die Satire
In ihrer knapp 2000-jährigen Geschichte war Satire immer ein literarisches Medium der Herrschaftskritik, mal wirksam, mal unwirksam, mal geduldet, mal unterdrückt. Besonders in diktatorischen Zeiten bewährten sich ihr Hintersinn und ihre Uneindeutigkeit, weshalb sie leicht zum Opfer von Verfolgung werden konnte. Geändert hat sich das erst in der DDR: Hier hat man, gut dialektisch, festgestellt, dass es keine gegen den Staat gerichtete Satire mehr geben könne, weil es auch keine Unterdrückten mehr gibt. Jetzt sei es Aufgabe der Satire, ihre „ätzende Kritik“ gegen „rückständiges, nicht-sozialistisches Denken und Verhalten“ zu richten.
Diese Auffassung von Satire gehört offensichtlich, wie das Ampelmännchen, zu jenen Kulturgütern, die sich aus der DDR in die Bundesrepublik hinübergerettet haben. Eigentlich war das anders gemeint. Wenn die großen Satiriker der abendländischen Literaturgeschichte zur Feder griffen, suchten sie nicht den Schulterschluss mit der Macht und schielten auch nicht auf die Geldtöpfe öffentlich-rechtlicher Anstalten.
Satire ist nicht beliebig. Satire setzt Wertmaßstäbe voraus, an denen sie die Verhältnisse misst. Aber sie setzt keine Zeichen, sie zeigt keine Haltung und sie sagt auch nicht, „was ist“. Satire sät Zweifel und sie nimmt den Dingen ihre Eindeutigkeit. Sie eröffnet Spielräume und Denkhorizonte dort, wo alle sich erst einmal einig sind. Sie weitet auch keine Debattenräume aus, von denen jetzt so viel die Rede ist. Sie untergräbt sie.
Aber Satire muss man können. Ihr stehen viele Stilmittel zur Verfügung: Humor, Komik, Witz, Ironie; allesamt höchst anspruchsvolle Formen uneigentlichen Sprechens. Sie setzen beim Autor wie seinen Lesern eine ausgeprägte Fähigkeit zum Umgang mit der Sprache voraus und ebenso einen weit ausgreifenden Bildungs- und Kulturhorizont. Niemand wird im Ernst behaupten wollen, dass diese Voraussetzungen bei der tageszeitung, beim wdr oder sonst irgendwo im Fernsehen oder bei politischen Redenschreibern gegeben seien, von den Social Media ganz zu schweigen.
Die Satire ist eine der ältesten und anspruchsvollen literarischen Gattungen überhaupt. Ihre Maßstäbe wurden gesetzt von Juvenal und Lukian, von François Rabelais und Johann Christoffel von Grimmelshausen, von Jonathan Swift und Christoph Martin Wieland, von Heinrich Heine und Mark Twain, von Karl Kraus und Kurt Tucholsky – und nicht von Oliver Welke oder Jan Böhmermann.