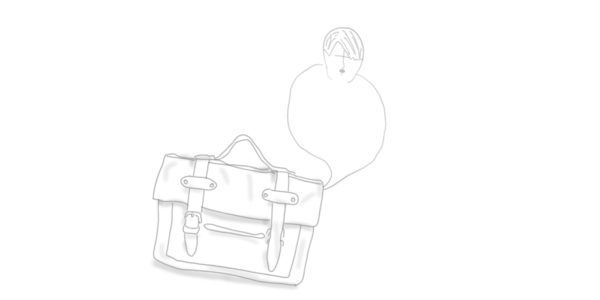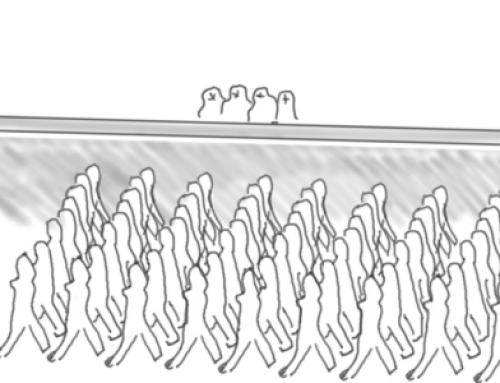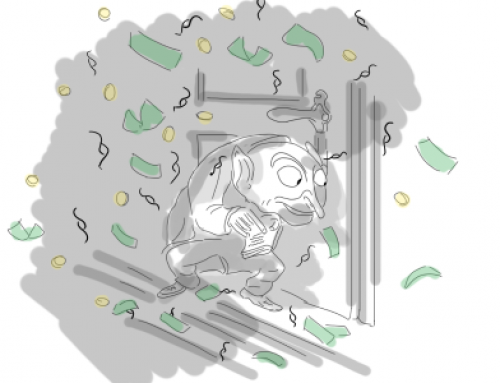Das Flugblatt in der Schultasche
Für Politiker mag es ganz praktisch sein, wenn sie sich nicht mehr daran erinnern können, mit wem sie sich vor sechs Jahren zum Essen getroffen und was sie dabei besprochen haben. Genauso praktisch ist es umgekehrt, wenn man sich daran erinnert, welches Flugblatt der politische Gegner vor 36 Jahren als Gymnasiast in der Schultasche mit sich herumgetragen haben mag. In der öffentlichen Diskussion wurde dieses Thema schnell auf die falsche Frage zugespitzt, was denn da für eine Gesinnung bei einem 16-jährigen Schüler des Jahres 1986 zu vermuten sei und ob man sie auch im Jahre 2023 noch annehmen dürfe. Die richtige Frage blieb aber ungestellt: die Frage, was man von einem bayerischen Gymnasium in einem solchen Fall erwarten darf.
Die besagte Schule, ein niederbayerisches Gymnasium, hat, nach allem, was man weiß, den bedenklichen Vorfall seinerzeit unter pädagogischen und nicht unter juristischen Gesichtspunkten behandelt, die angesichts der Rechtslage im Jahre 1986 ohnehin kaum in Frage gekommen wären. Das ist nicht der schlechteste Ansatz. Denn in einer modernen westlichen Gesellschaft ist die Schule nach wie vor ein „geschützter Raum“ – und das ist etwas anderes als der „safe space“, als den sich die Schneeflöckchen-Generation ihre Bildungsanstalten wünscht.
Die Schulleitung hat damals wohl alles richtig gemacht. Keine besondere pädagogische Glanzleistung ist es freilich, wenn ein fanatisierter Studienrat des Gymnasiums das inkriminierte Flugblatt an sich nimmt, möglicherweise sogar aus dem Aktenbestand des Gymnasiums, es über drei Jahrzehnte lang aufbewahrt, um es als Waffe im politischen Tageskampf gegen seinen ehemaligen Schüler einzusetzen. Der Mann war, wie man hört, Deutsch- und Lateinlehrer an einem Gymnasium, das den Namen eines regionalen Benediktinerabtes aus dem 12. Jahrhundert trägt. Angesichts dieser Konstellation fühlt man sich an die ratlose Frage erinnert, die Alfred Andersch in seiner lesenswerten letzten Erzählung „Der Vater eines Mörders“ – gemeint ist Heinrich Himmler – gestellt hat: „Schützt Humanismus denn vor gar nichts?“
Es geht um die Gegenwart
In der Schule müssen politische Konflikte anders ausgetragen werden als in der Arena der öffentlichen Auseinandersetzung. Der Umgang mit der Vergangenheit, speziell der deutschen Vergangenheit, ist politisch wie pädagogisch ein hochbrisantes Thema. Hier geht es nicht einfach um die Vermittlung von geschichtlichem Faktenwissen; hier geht es auch um politische und moralische Wertungsfragen, die unmittelbar in die Gegenwart hineinreichen.
Die Frage, warum man überhaupt Geschichtswissenschaft betreibt und historisches Wissen vermittelt, ist nicht neu und die Antwort ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. In seiner berühmten zweiten „Unzeitgemäßen Betrachtung“ mit dem Titel „Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“ hat Friedrich Nietzsche 1874 eine Antwort gegeben. Nietzsche beschreibt bekanntlich drei Formen der Geschichtsschreibung: die „antiquarische“, die vorgibt zu wissen, „wie es eigentlich gewesen sei“, die „monumentalische“, welche herausragende Momente der Geschichte glorifiziert, und schließlich die von Nietzsche favorisierte „kritische“, welche die Vergangenheit im Hinblick darauf bewertet, in welcher Weise sie dem Leben in der eigenen Gegenwart diene oder aber ihm schädigend entgegenstehe.
Das ist auch knapp eineinhalb Jahrhunderte später der Ansatzpunkt einer Erinnerungskultur, die nicht nur danach fragt, wie es gewesen ist, sondern auch danach, was das für die Gegenwart bedeutet. Dadurch werden historische Fragen immer wieder zu politischen Fragen, die nicht einfach als „antiquarische“ Aktenvermerke abgelegt werden können.
In der deutschen Schule hat man seit langem einen modus vivendi für den Umgang mit dieser Problemlage gefunden. Die Grundlage für die Behandlung politischer Themen im schulischen Unterricht ist bis heute der „Beutelsbacher Konsens“ von 1976. Damals hatte man sich nach kontroversen Diskussionen – es war die Zeit nach 1968 – darauf verständigt, dass bei politisch sensiblen Themen drei fundamentale Grundsätze beachtet werden müssen: Das „Überwältigungsverbot“ untersagt die politische Indoktrination von Schülern; kontroverse Positionen müssen in ihrem Für und Wider sachgerecht dargestellt werden und schließlich soll den Schülern die Fähigkeit vermittelt werden, ihre eigenen Gegenwartsinteressen zu erkennen und reflektiert zu analysieren. Mit diesen drei Grundsätzen tun sich die deutschen Schulen zunehmend schwer. Denn in bestimmten Politikbereichen, vom „Klimaschutz“ über „Antirassismus“ und den „Kampf gegen rechts“ bis hin zur LGBTQ+-Bewegung, darf es kein Für und Wider mehr geben, sondern nur noch eine, und zwar die richtige, Meinung.
Deutsche Erinnerungskultur
Unter den politischen Großthemen des Schulunterrichts nimmt der Nationalsozialismus eine Sonderstellung ein. Den Hauptnachrichten des Ersten Deutschen Fernsehens war es am 21. Februar 2023 eine Nachricht wert, dass sich „junge Menschen in Deutschland“ zwischen 15 und 25 Jahren „überdurchschnittlich“ für die „Geschichte des Nationalsozialismus“ interessieren. Das habe eine „Studie“ herausgefunden. Ein Drittel der Jugendlichen – sind das „überdurchschnittlich“ viele? – gab an, sich „ausführlicher mit der NS-Zeit auseinandergesetzt zu haben“. Die Kehrseite dieses Interesses wurde etwas verschämt hinterhergeschoben. Die Jugendlichen „interessieren“ sich zwar für den Nationalsozialismus, haben aber keine Ahnung, was ohnehin ein Grundelement speziell der gymnasialen Didaktik zu sein scheint: „Bei den Fakten hinsichtlich Zeitraum, Täter und Opfer gibt es laut der Studie noch viel Wissenslücken“ – es ist der Tat so, dass selbst deutsche Studenten Mühe haben, auch nur die beiden Eckdaten der NS-Zeit richtig zu benennen.
Man darf übrigens vermuten, dass inzwischen eine Lehrergeneration in den Klassenzimmern steht, die genauso wenig Ahnung hat wie ihre Schüler, weil auch sie schon Opfer einer schulischen und universitären Ausbildung wurde, in der fachliches historisches Wissen durch emotionalisierte Haltung abgelöst wurde. Ob sich diese Defizite durch Lehrerfortbildungen korrigieren lassen, ist nicht gewiss. Deutsche Universitäten bieten zwar so avancierte Themenkomplexe wie „Antiziganismussensible Bildungsberatung und Demokratiebildung“ in der Form einer „Blended-Learning-Weiterbildungsreihe für Student:innen, Lehrende und andere Mitarbeitende“ an, aber so richtig hilft das auch nicht weiter, wenn man etwas über die Wirkungsmechanismen des nationalsozialistischen Rassismus erfahren will.
Dass deutsche Jugendliche sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben, wie die „Tagesschau“ versichert, ist nicht überraschend. Das Thema steht auf den Lehrplänen aller deutschen Schularten, in der Regel in der 9. Klasse. Auch der Besuch von KZ-Gedenkstätten ist Teil schulischer Lehrpläne, er gehört allerdings nur in Bayern und hier nur an Gymnasien zum curricularen Pflichtprogramm. 2015 scheiterte ausgerechnet ein Antrag der Freien Wähler, den Besuch einer NS-Gedenkstätte auch in den Lehrplänen von Real-, Mittel- und Förderschulen zu verankern.
Für diese „Holocaust Education“ gibt es einen festen Rahmen. Die 1989 in Stockholm gegründete „International Holocaust Remembrance Alliance“, die seit 2008 auch ein Sekretariat im Auswärtigen Amt unterhält und 34 Mitgliedsstaaten hat, hat in ihrer „Stockholmer Erklärung“ von 2000 die Ziele ihrer Arbeit festgelegt. Die Richtlinien der Allianz legen als vornehmliche Ziele der „Holocaust Education“ zunächst fest, die Erinnerung an den Völkermord an den Juden wachzuhalten und in allen Bildungseinrichtungen zu verankern sowie eine Gedenkkultur zu etablieren. Zugleich soll ein Gegenwartsbezug hergestellt werden.
Das ist gut gemeint. Wie weit das trägt, ist eine andere Frage. Die von dem Kölner Psychologen Ulrich Schmidt-Denter geleitete „Europäische Identitätsstudie“ ist auch auf den deutschen Sonderfall der „Holocaust Education“ eingegangen und hat nach den tatsächlichen bewusstseinsbildenden und handlungsleitenden Effekten des Geschichtsunterrichts in Bezug auf Nationalsozialismus und Holocaust gefragt.
Das Ergebnis ist ernüchternd. Die vom Geschichtsunterricht erwartete „Transferleistung“, also die Übertragung historischen Wissens auf gegenwärtige Verhältnisse, stellt sich kaum ein. Der tatsächliche Befund sieht anders aus, als die Lehrplangestalter es sich ausgedacht haben. Bereits drei Monate nach dem Unterricht oder dem Besuch einer Gedenkstätte sind kaum noch Effekte des Unterrichts messbar. Weder lässt sich eine Steigerung der Toleranz erkennen noch ein Abbau von Xenophobie und Antisemitismus
Erinnerung im Widerstreit
Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags hat 2018 in einer Untersuchung der Schullehrpläne einen erstaunlichen Befund erarbeitet: Gegenüber 2006 sei die Bedeutung des Nationalsozialismus im Unterricht zurückgegangen, der „rassistische Antisemitismus als Kern der nationalsozialistischen Ideologie“ spiele in der Hälfte der Lehrpläne keine Rolle mehr und die Singularität der nationalsozialistischen Verbrechen, die seit dem „Historikerstreit“ von 1986 zu den unverrückbaren Bestandteilen deutscher Erinnerungskultur gehört, werde kaum noch explizit hervorgehoben.
Die Bedeutung dieser Befunde erschließt sich nicht von selbst. Auf den ersten Blick ist alles beim Alten geblieben. Die Fronten sind klar: Der Feind steht rechts und muss bekämpft werden. Gerade erst hat die deutsche Innenministerin auf der Grundlage dieses unumstößlichen Konsenses einen vernichtenden Doppelschlag gegen den Rechtsextremismus führen können: Die beiden rechtsextremen Vereinigungen „Artgemeinschaft“ (geschätzte 150 Mitglieder bundesweit) und „Hammerskins“ (geschätzte 120 Mitglieder bundesweit) wurden unter dem Einsatz von Hunderten von Polizisten verboten.
Nicht verboten wurde hingegen die größte rechtsextremistische Vereinigung in Deutschland, deren Mitgliederzahl der Verfassungsschutz auf 12 100 Personen beziffert. Deren Schonung mag damit zusammenhängen, dass ihre Auftraggeber und Hintermänner ihren Sitz in der Türkei haben, wo die Gruppierung ihre ethnischen Wurzeln hat. Die Gruppierung nennt sich „Ülkücüler“, in Deutschland ist sie unter dem Namen „Graue Wölfe“ bekannt.
Dieses merkwürdige Ungleichgewicht in der Bekämpfung rechtsextremer Strömungen in Deutschland verweist auf das ideologische Dilemma, in das die deutsche Erinnerungspolitik hineinmanövriert wurde. Denn die alten Selbstverständlichkeiten sind ins Wanken geraten. Die gut etablierte deutsche Erinnerungskultur wird inzwischen nicht mehr unwidersprochen akzeptiert.
Soweit die Bundesrepublik Deutschland überhaupt eine nationale Identität hat, ist sie auf die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus gegründet. Aber dieses erinnerungspolitische Geschichtsbild hat Risse bekommen, nicht etwa, weil es von fachlicher, also geschichtswissenschaftlicher Seite in Frage gestellt worden wäre – auch wenn es dafür durchaus Ansatzpunkte gegeben hätte –, und auch nicht deshalb, weil andere politische Kräfte ein anderes Geschichtsbild hätten durchsetzen können.
Mit beidem ist auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Risse bekommen hat dieses Geschichtsbild, weil sich die Zusammensetzung der deutschen Wohnbevölkerung in den letzten Jahren deutlich verändert hat und sich weiter verändern wird. Deshalb ist es völlig problemlos möglich, unter umfassender medialer Zustimmung rechtsextreme Vereinigungen wie die „Artgemeinschaft“ oder die „Hammerskins“ zu verbieten. Aber wenn man das auch mit „Ülkücüler“ versuchen würde, könnte es heikel werden. Dann könnte der Beifall ausbleiben.
In der Schule ist das nicht anders. Mit einer Gymnasialklasse eine bayerische KZ-Gedenkstätte zu besuchen, ist kein Problem. Aber Lehrer von berufsbildenden Schulen und speziell solche von „Berufs-Integrations-Klassen“ haben lernen müssen, dass sie solche Ausflüge besser unterlassen. Der migrantische Anteil ihrer Schülerschaft reagiert anders auf die Besuche von KZ-Gedenkstätten, als es im Lehrbuch der politischen Bildung vorgesehen ist.
Diese Entwicklung hat in jüngster Zeit auch den öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs erreicht. Der Vorwurf, dass sich die deutsche Erinnerungspolitik mit ihrer Zentrierung auf den Antisemitismus auf die falsche Seite der Geschichte geschlagen habe, ist nicht nur salonfähig, sondern in manchen akademischen und medialen Kreisen zustimmungspflichtig geworden. Denn offensichtlich hat der importierte Antisemitismus eine andere moralische Wertigkeit als der autochthone.
Das hat eine enorme politische Sprengkraft. Die in Deutschland jahrzehntelang gut funktionierende Erinnerungskultur wird von neuen akademischen Strömungen unterspült, die ihren Ursprung in den USA haben und in Deutschland zunehmend stärkeren Zuspruch finden. Die „Critical Race Theory“ sickert auch in deutsche Universitäten und die ihnen angelagerten Medien ein. Diese „CRT“ wiederum ist eng verbunden mit dem Konzept der „Critical Whiteness“, zu deutsch: „Weißseinsforschung“, die wiederum von Bundesfamilienministerium – das sich längst nicht mehr nur mit harmlosem „Gedöns“ beschäftigt, wie ein früherer Bundeskanzler glaubte – freundlich gefördert wird.
Nach und nach wird der Rassismus, und mit ihm vor allem der Antisemitismus, neu definiert. Die Ermordung der europäischen Juden wird nicht mehr als ein singuläres Menschheitsverbrechen auf rassistischer Grundlage begriffen. Denn um Rassismus könne es sich hier nicht handeln, da Weiße von Weißen ermordet wurden, und Rassismus gegen „Weiße“ sei schlechterdings nicht denkbar – „Weiße“ sind nach dieser Theorie immer privilegiert, auch dann, wenn sie millionenfach ermordet werden. Eigentlich sollte man meinen, solchen Unsinn stillschweigend ignorieren zu können.
Aber es wird nicht mehr lange dauern, bis er herrschende Lehrmeinung an deutschen Universitäten geworden sein wird. Gelehrt wird er dort jetzt schon, und dass das bald auch in den Klassenzimmern ankommen wird, ist abzusehen. Dann haben die deutschen Schulen ein echtes Antisemitismusproblem.
***
Am 10. September 2023 wurde im „Kontrafunk“-Internetradio in der Reihe „Audimax – das Kontrafunkkolleg“ der Hörfunkvortrag
Die Schule der Demokratie?
Protestkultur in Deutschland seit 1945
von Peter J. Brenner gesendet.
Die Sendung ist im Podcast hier gebührenfrei verfügbar.
Der 17. Juni 1953 und „1968“ sind die herausragenden Ereignisse in der deutschen Protestgeschichte seit 1945. Ansonsten gelten die Deutschen nicht als besonders protesttüchtig. Aber wenn auch die spektakulären Großereignisse weitgehend fehlen, so haben die Anti-Kernkraft-, die Friedens– und die Umweltschutzbewegung Konflikte erst geschürt, sodann absorbiert und schließlich zu einer Konsenskultur umgeformt. Seit 2010 treten die politischen Konfliktlinien wieder schärfer hervor, und mit dem „molekularen Bürgerkrieg“ etabliert sich eine neue und zukunftsträchtige Protestvariante.